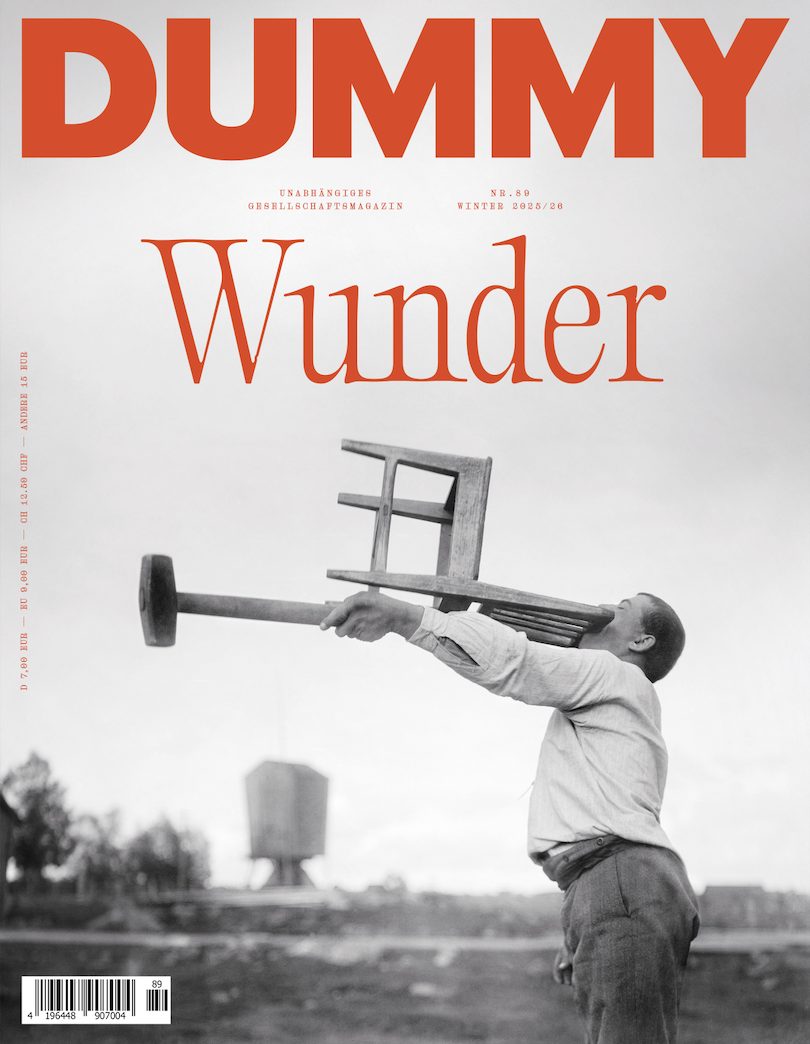Gekommen, um zu bleiben
Outdoor-Kleidung, Bratpfannen und Shampoo: Kein Giftstoff ist so verbreitet wie PFAS – und so schwer wieder loszuwerden. Nämlich gar nicht
Von Svenja Beller; Illustrationen von Kirstin Klassen
Kapitel I: Die Feinde
Das Gemeine an ihnen ist, dass man sie nicht sehen kann. So konnten sie sich heimlich überall einnisten, wirklich überall. Sie schwimmen in jedem Tropfen unseres Blutes, das heißt, jeder Herzschlag ist ein Herzschlag mit ihnen. PFAS. Die Abkürzung steht für per- und polyfluorierte Chemikalien, und die sind nicht nur in unserem Blut, sondern auch im Boden, in den Pflanzen, im Grundwasser, im Meeresschaum an deutschen Küsten, im arktischen Eis, in Wüstenoasen in New Mexico, in Bären, Delfinen, Tigern, am höchsten Punkt der Welt auf dem Mount Everest und am tiefsten Punkt im Marianengraben – ja, sie regnen mit jedem Regentropfen auf uns nieder.
Da sind sie natürlich nicht von allein hingekommen. Die PFAS-Industrie hat sie unbekümmert verbreitet und auch all jene Industrien, die die Chemikalien in ihren Produkten verwenden. Und das sind richtig viele. Fangen wir mal von vorne an: Erfunden wurden die ersten PFAS in den Dreißigerjahren, und zwar zufällig. Der US-Chemiekonzern DuPont machte daraus 1945 dann den bis heute bekanntesten Stoff aus der PFAS-Familie: Teflon, eine wasser-, fett- und schmutzabweisende Wunderwaffe. In den folgenden Jahrzehnten geriet die Industrie in eine Art PFAS-Rausch: Sie beschichtete Pfannen, Brillen, Tennisschläger, Schuhe, Jacken (unter dem Namen Goretex), Tischtücher, Teppiche, Papier und Pizzakartons, mischte sie in Feuerlöschmittel, Skiwachs, Kühlschrankgase, Metall- und Kunststoffoberflächen, Halbleiter, Shampoos, Gesichtscremes, Make-up-Puder, Mascara und noch vieles mehr. „Super Stay“, „Waterproof“, „Antihaft“ sind ihre Werbeversprechen.
Mittlerweile gibt es so viele PFAS, dass niemand weiß, wie viele genau. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) listet rund 4.700 Stoffe auf, die US-Umweltbehörde mehr als 12.000 und die Datenbank PubChem sogar mehr als sechs Millionen. Die letzte Zahl sei aber eher als „theoretische Möglichkeit“ zu verstehen, schreibt das deutsche Umweltbundesamt dazu. Aha.
Aus all den Produkten, in die sie als alles könnende Wunderwaffen eingearbeitet werden, lösen sich die PFAS wieder heraus. Und deswegen sind sie jetzt in meinem Herz, in deinem Herz und in denen von Eisbären. Und da bleiben sie auch, denn PFAS bauen sich nicht ab. Die erste Ladung bekommen wir direkt mit der Muttermilch, und von da an werden es unser Leben lang immer mehr. PFAS werden deswegen auch „Ewigkeitschemikalien“ genannt. Selbst wenn die Menschen eines Tages aussterben, wird es sie immer noch geben.
Kapitel II: Der Chemiker
Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie schlimm ist das?
„Zehn“, sagt Martin Scheringer, ohne zu zögern. Er ist Chemiker an der ETH Zürich und PFAS-Experte. Er erklärt seine Antwort mit einer Landkarte, der „Forever Pollution Map“, auf der die französische Zeitung „Le Monde“ und siebzehn Partner PFAS-Verschmutzungen in Europa eingetragen haben, für jeden Nachweis einen roten Punkt. Europa ist darauf mit rund 23.000 Punkten übersät, als hätte unser Kontinent Masern. „Deswegen zehn, es ist wirklich maximal schlecht“, sagt Scheringer.
Das große Problem der PFAS ist nämlich: Sie sind nicht nur alles könnende Chemikalien, sie sind auch giftig. „Und das hat man schon früh gewusst“, sagt Scheringer. „Der US-Hersteller 3M hat das schon in den Siebzigerjahren mit Affen-experimenten festgestellt.“ Auch der amerikanische Konzern DuPont bemerkte zur selben Zeit schon, dass sich die Chemikalien in seinen Mitarbeitenden anreicherten – und dass sie davon krank wurden. Sie litten an gestörten Leberfunktionen, Schilddrüsenerkrankungen, hormonellen Störungen und Krebs. Und die Arbeiterinnen brachten vermehrt missgebildete Babys zur Welt. Die Unternehmen hielten all das geheim und verkauften die Chemikalien weiter – ähnlich wie die Tabakindustrie das auch mit Zigaretten tat, als sie längst wusste, wie schädlich sie sind. Manche nennen PFAS deswegen den Tabak der Chemieindustrie. Der Unterschied ist nur: Während wir uns entscheiden können, ob wir eine Zigarette rauchen oder nicht, können wir das bei PFAS nicht: Wir nehmen sie unfreiwillig in unsere Körper auf, jeden Tag.
Manchmal sogar, wenn wir es vermeintlich besser machen wollen, zum Beispiel, wenn wir statt Plastikeinweggeschirr und -strohhalmen der Umwelt zuliebe welche aus Zuckerrohr oder Papier benutzen – die sind nämlich oft richtig stark mit PFAS behandelt. Martin Scheringer rät dazu, wann immer möglich, aus Glas, Metall oder Keramik zu essen und zu trinken.

Werden wir alle krank, wenn wir das nicht tun? Unklar, denn bei welchen Grenzwerten welcher Stoff gefährlich wird, ist kaum erforscht. Bei einer europaweiten Untersuchung kam 2022 aber heraus, dass bis zu einem Viertel der Kinder und Jugendlichen in so hohen Konzentrationen mit PFAS belastet ist, dass gesundheitliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden können.
Die Chemikalien nehmen wir übrigens nicht nur über Produkte auf, sondern auch über das Grundwasser, Böden, Pflanzen, Regen und Luft. „Trotzdem haben die PFAS-Hersteller immer noch Genehmigungen, ihre giftigen Abwässer in die Umwelt zu leiten“, sagt Martin Scheringer. Inzwischen hätten die meisten Unternehmen in Reinigungsverfahren investiert, ganz frei von den Chemikalien seien die Abwässer aber immer noch nicht. Von den Produktionsstätten aus machen sie sich in Flüssen, Fischen und Pflanzen auf die Reise. „Und wir kriegen die da nicht mehr weg.“ Theoretisch ließen sich Wasser und Böden schon weitestgehend von PFAS reinigen, aber das ist sehr aufwendig, sehr teuer und angesichts des schieren Ausmaßes der Verunreinigung so gut wie unmöglich.
An manchen Orten wird das dennoch gemacht, weil die PFAS-Belastungen dort alle Grenzwerte sprengen. Das bayrische Altötting in der Nähe des PFAS-Herstellers 3M ist so ein Ort oder der Flughafen Düsseldorf, an dem die Feuerwehr mit PFAS-haltigem Löschschaum trainierte. Oder Rastatt in Baden-Württemberg, direkt an der Grenze zu Frankreich.
Kapitel III: Der Hotspot
Lange Zeit durften die Menschen in Rastatt ihr Leitungswasser nicht mehr trinken. Heute müssen die Landwirte ihre Felder auf unabsehbare Zeit regelmäßig auf PFAS testen. Wird in den Erdbeeren, dem Spargel oder dem Salat etwas gefunden, muss die ganze Ernte vernichtet werden, ohne Entschädigung. Es gibt hier keinen Chemiekonzern wie in Altötting und keinen Feuerwehrübungsplatz wie in Düsseldorf – wie kommen die PFAS also hierhin?
Bis 2008 haben die Landwirte in Rastatt Dünger auf ihre Felder gespritzt, der mit Papierschlamm, also giftigen Rückständen aus der Papierindustrie, versetzt war und von einem Komposthändler aus der Gegend kam. Das Beimischen von Papierfasern war bis zum Jahr 2003 legal, allerdings tat es der Komposthändler noch fünf weitere Jahre. Aber das ist lediglich ein Verstoß gegen die Düngemittelverordnung. Dass die Papierfasern mit PFAS belastet waren, wussten vermutlich weder der Händler noch die Bauern. Nun dürfen sie nur noch Pflanzen anbauen, die PFAS nicht so stark speichern: Wintergerste statt Winterweizen, Hafer statt Soja, Winterraps statt Silomais. An vielen Stellen ist das Brunnenwasser immer noch zu stark belastet, um verwendet zu werden. Das Leitungswasser reinigen die Stadtwerke mittlerweile mit Aktivkohlefiltern. All das kann die jahrelange Vergiftung allerdings nicht rückgängig machen: Die PFAS-Belastung der Menschen in Rastatt ist fast achtmal höher als die der übrigen Bevölkerung.
In dem 2019 erschienenen Hollywoodfilm „Dark Waters“, der die wahre Geschichte eines PFAS-Hotspots in den USA nacherzählt, sterben erst die Kühe und dann die Menschen. In Rastatt sind solche drastischen Folgen bislang nicht dokumentiert. Für Marike Kolossa vom Umweltbundesamt ist das aber kein Grund zur Entwarnung. Sie sagt: „Nur weil bestimmte Effekte in Studien nicht oder nicht ausreichend untersucht wurden, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt.“
Kapitel IV: Die Lobby
PFOA – ein PFAS-Stoff, der schon in den Siebzigern Affen bei Experimenten krank machte – ist mittlerweile weitgehend verboten. Das bringt aber leider nicht so furchtbar viel, denn er wird durch sehr ähnliche Stoffe ersetzt. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass auch diese Ersatzstoffe giftig sind. Bloß kommen die Behörden, die sich mit dem Gefahrenpotenzial von PFAS beschäftigen, angesichts der Tausenden Stoffe einfach nicht hinterher.
Deutschland machte daher zusammen mit Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden 2023 einen Vorschlag: Im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung REACH wollten die Länder eine „universelle Beschränkung“ für PFAS erreichen. Schon drei Jahre zuvor hatte die EU-Kommission in ihrer Chemikalienstrategie konstatiert: „Obwohl ihr Beitrag zur globalen Krankheitslast nach wie vor unterschätzt wird, ist die Verschmutzung durch Chemikalien anerkanntermaßen eine Bedrohung für das Recht auf ein Leben in Würde.“ Das machte Hoffnung.

Doch heute, zwei Jahre später, stellt die EU-Kommission die REACH-Verordnung bereits wieder infrage. Und die neue deutsche Regierung unter Kanzler Merz verkündet in ihrem Koalitionsvertrag: „Ein Totalverbot ganzer chemischer Stoffgruppen wie Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) lehnen wir ab.“
„Das ist ein ganz klarer Lobbyerfolg. Es geht überhaupt nicht um ein ‚Totalverbot‘. Davon zu sprechen, ist sachlich falsch und irreführend“, sagt Chemiker Martin Scheringer. „Es geht um eine Beschränkung, die Ausnahmen für wichtige Anwendungen vorsieht.“
Natürlich war die Chemieindustrie wenig erfreut über den Vorschlag, PFAS großflächig einzuschränken. Also reagierte sie mit einer massiven Desinformationskampagne und flutete die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) mit mehr als 5.600 Kommentaren zu dem Beschränkungsvorschlag. Die Lobbyisten bezogen sich dabei immer wieder auf die OECD, die einige PFAS vor Jahren angeblich als „kaum bedenklich“ eingestuft haben soll. Die Crux daran: Das ist gelogen. Und noch viel schlimmer: Bei der Politik fand die Lobby damit Gehör. Zum Beispiel bei Nicole Hoffmeister-Kraut, der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin. Sie übernahm in einem Brief an die EU-Kommission kurzerhand die Lüge, die OECD habe einige PFAS als „kaum bedenklich“ eingestuft. Ja, selbst das Bundeswirtschaftsministerium unter dem Grünen Robert Habeck kopierte diese Falschinformation in internen Papieren.
Ob es der Lobby gelingt, auch den Beschränkungsvorschlag so zu untergraben, entscheidet sich frühestens in einem Jahr. So lange wird die ECHA brauchen, um den Vorschlag – und alle Kommentare – durchzuarbeiten.Zumindest ein Unternehmen hat inzwischen reagiert: Der US-amerikanische Konzern 3M will die Produktion der umstrittenen PFAS-Chemikalien bis Ende des Jahres einstellen – nicht ganz freiwillig, sondern wegen „sich beschleunigender regulatorischer Trends“, wie es heißt. Doch für die Umweltschäden, die in Jahrzehnten entstanden sind, fällt die Verantwortung bislang eher symbolisch aus: 3M beteiligte sich an der Finanzierung der Wasserfilter für die Gemeinde Altötting und an einer Art Abschussprämie für Jäger im Landkreis. Zwischen 110 und 220 Euro gibt es pro Wildschwein, das verseucht durch die Wälder streift – ein Beitrag zur Schadensbegrenzung, der eher nach PR als nach echter Wiedergutmachung klingt.
Nachtrag: Ende Juni wurden elf ehemalige Führungskräfte des insolventen italienischen Chemieunternehmens Miteni SpA (Tochter von Mitsubishi) von einem italienischen Gericht wegen einer der europaweit größten Grundwasserkontaminationen durch sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ zu insgesamt 141 Jahren Gefängnis verurteilt.
Von den 1960er Jahren bis zur Insolvenz von Miteni im Jahr 2018 stellte der Chemiehersteller in seinem Werk in der Nähe von Vicenza Produkte her, die PFAS-Chemikalien enthielten. Sie verursachten in der Gegen eine Häufung von schweren Gesundheitsproblemen, darunter Krebs, Unfruchtbarkeit, Geburtsfehler und Störungen des Immunsystems.
Zum Heft