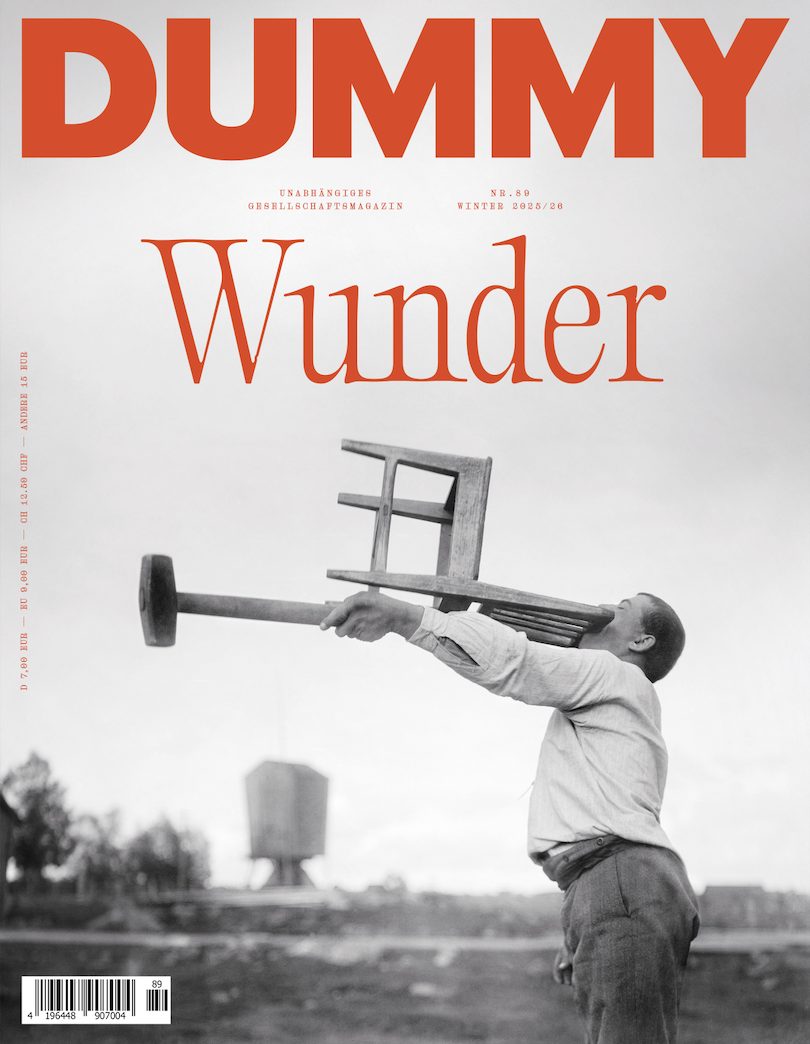Der Himmel über Brändenbörg
Nie „on the road“, immer nur von A nach B, aber nicht hier, im Speckgürtel von Berlin, wo der Himmel weit ist und die Lust nach gesundem Leben weit weg
Von Dirk Gieselmann
In die Südstaaten fahre ich von Berlin aus immer über die Autobahn 9. Dort liegen zwar nicht Texas, Alabama und Louisiana, aber immerhin die Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark. Wo die Mädchen Cheyenne und Britney heißen und die Jungs sich diese Namen auf den Hals tätowieren lassen, „forever“. Wo die Kühe glücklich sind und die Ansichten rückständig. Das deutsche Dixieland. Brändenbörg, ei lahw ju.
Mit 16 Jahren habe ich „Unterwegs“ von Jack Kerouac gelesen und mich seither danach gesehnt, in einem geschwungenen Straßenkreuzer unendliche Weiten zu durchmessen. Unangeschnallt, leicht einen sitzen habend. Den Sternenhimmel über, meinen besten Kumpel Henning, der in meinen Träumen Hank hieß, neben und zwei von zu Hause ausgerissene Blondinen hinter mir. Und schließlich würden wir, nach 1.000 Meilen Nacht, erschöpft, aber auf magische Weise euphorisch, in einen Diner einkehren, der einsam am Highway liegt wie ein Asyl für Schlafwandler, auf einen „black coffee“ und einen Blaubeerkuchen. „Darling“, haucht die eine Blondine mir zu, kurz bevor wir weiterfahren. In breitem Amerikanisch, mit einem Kaugummi im Mund. Sie kommt aus einem kleinen Dorf in den Appalachen. Ihr Vater ist ein trunksüchtiger Holzfäller.
Doch spätestens seit meiner Führerscheinprüfung sehe ich mich der tristen Wirklichkeit des hiesigen Verkehrs ausgesetzt. Anschnallpflicht, Alkoholverbot und vor allem: ein Straßennetz, das so dicht ist wie die Adern im Gesicht eines alten Mannes. Zielloses Umherfahren als Absage an die Gesellschaft, als von einem sagenhaften Beat getriebene Dynamik, ist in diesem Land schlechterdings unmöglich. Alle fünf Kilometer leuchtet eine Tankstelle, einmal Pinkeln kostet 70 Cent, und im Snack-Bistro welkt der Mozzarella. Im Autoradio läuft nicht Carl Perkins, sondern bestenfalls Gunter Gabriel. Ausgerissene Blondinen, so es sie denn überhaupt noch gibt, überholen kalt lächelnd meinen beschissenen Golf II im SUV ihres Vaters, eines crossfittenden Anlageberaters. Und überall sind Menschen, einfach zu viele Menschen. Ich bin nie „on the road“, ich fahre nur von A nach B, bin nie frei, weder kinetisch noch existenziell, denn ich muss mich einfach zu sehr aufs Reißverschlusssystem konzentrieren. Fucking Germany.
Außer manchmal, an seltenen Tagen, wenn ich all meine Fantasie zusammennehme und mit gewollter Energie hinausfahre in dieses mystisch-dubiose „Wasteland“, das gleich hinter Lichtenrade beginnt. Das Amerika des kleinen Mannes. Mein Amerika.
Leer, weit und groß öffnet es sich, wie ein verlassener Hangar ohne Wände und Dach. Der Himmel ist größer und blauer, und wenn ich nicht wüsste, dass Harald Martenstein hier irgendwo auf seinem Manufactum-Fahrrad herumkurvt, auf dem Weg zum Biobauern, wahrscheinlich pfeifend, bekäme ich bei diesem Anblick gleich epiphanische Gefühle. Aber auch mit Martenstein an ihren Rändern bleiben die Straßen herrlich lang, sie führen ins Nichts oder nach Mittenwald, was das Gleiche ist. Die Windräder rotieren nicht so geschäftstüchtig wie anderswo, sie drehen sich so gemächlich wie „Westernmills“ in der Prärie. Die Autos werden von ihren Besitzern geliebt, als wären sie treue Pferde, und eines Tages durch einen Schuss in die Motorhaube von ihrem Leid erlöst. Hier fährt auch der Berliner Agenturchef seinen Ford Mustang, beide Baujahr 63, spazieren, der in der Großstadt wirkt wie das Accessoire eines geckenhaften Lustgreises. In Brandenburg aber, wo die Zeit ohnehin stillsteht, gleitet er mit einer Selbstverständlichkeit dahin, die keine Rotphase je wird stören können.
Es ist fast zwangsläufig, so scheint mir, dass sich in diesem weltabgewandten Landstrich eine Art pseudoamerikanischer „Hillbilly“-Kultur ausgebildet hat. Die Typen von Boss Hoss, für Puristen so etwas wie die Wildecker Herzbuben des Country, gelten hier als wahre Cowboys. Rebellenflaggen wehen über den Carports, die Kinder sind rosafarben wie zu süße Bonbons, Katy Perry ist die schönste Frau der Welt. Michaels werden Mike genannt, nicht selten mit heroischen Präfixen wie Big oder Eisen. Sie sind „Rednecks“, die dem Ruf der weiten Welt widerstanden haben und samstags selbst geschossene Hirsche aufs Barbecue werfen. Nach Berlin fahren sie nur, um ihre verwirrten kleinen Schwestern aus der Scheiße zu holen.
Geschmacklosigkeit und Freiheit, Hinterwäldlertum und Lebenslust. Es gibt einen Ort, an dem sich all das ballt: den brandenburgischen Diner. Mein „guilty pleasure“, mein „sad hobby“. Hier esse ich, wenn ich die Schnauze voll habe von ungesättigten Fettsäuren, Raukesmoothies und Glutenfreiheit, von Jutebeuteln, „skinny jeans“ und ihren Trägern, von der Partymetropole Berlin und diesem ewigen November, der mich im August schon belauert. Hier esse ich, nein, fresse ich, wie ein Hund Gras frisst, wenn der Regen kommt.
Ich bin ein dummer Junge, denke ich noch, soeben einparkend, aber wie könnte ich daran vorbeifahren? Wenn ich mich irgendwo auch nur ein bisschen für Sal Paradise halten kann, dann doch wohl hier. Neben dem aluminiumglänzenden Diner, der dasteht, als wäre er ein vom Himmel gefallener Amtrak-Waggon, sieht sogar der McDonald’s nebenan so unamerikanisch aus wie eine Schrankwand. Die Toiletten heißen „Restrooms“, der Ausgang „Exit“, an der Decke kreist ein müder Ventilator. Die Apostrophe in der Speisekarte sind allesamt richtig gesetzt, was gerade hier an ein Wunder grenzt, die Burger wiegen ein halbes Kilo. Es ist jederzeit möglich, dass am Tresen zwischen zwei lokalen Footballteams eine Schlägerei um eine Flasche Heinz-Ketchup ausbricht. Die Lastwagen, deren Fahrer nach einem Schlafplatz suchen, scheinen mit texanischem Akzent zu hupen, ich bin versucht, sie „Trucks“ zu nennen. Und auch wenn ihre Fahrer Badeschlappen statt Lederstiefel tragen und auf den Anhängern „Rollladenzubehör Schmidtke“ steht – this must be the heart of Dixie.
Den Tag über ist der Diner beinah verwaist, im Sommer brüllt die Hitze gegen die Fenster, und wenn der linierte Schatten der Rippenjalousien auf ihre Gesichter fällt, sehen selbst Mannheimer Handelsvertreter aus wie vierschrötige Privatdetektive. Wüstenwind weht über den Parkplatz, es riecht nach Benzin und Frittieröl, ein Steppenläufer rollt vorüber, ins Nichts, nach Mittenwalde. Aus den Boxen dringt in Supermarktlautstärke eine Kirmesversion von „Wicked Game“, die Kellnerin löst, halb dösend, Kreuzworträtsel in der „Super-Illu“, und irgendwo in Waco kämmt sich Chris Isaak die Tolle mit seinen Tränen.
Doch um Punkt 18 Uhr, 6 p.m., ganz plötzlich, wie losgelassen, drängen ganze Kohorten herein, Gruppen wuchtiger Männer nehmen das „All you can eat“ wörtlich, ihre Bäuche quellen alsbald aus den Hemden und liegen auf ihren Oberschenkeln wie weiße, erschöpfte Katzen. Mädchencliquen schlürfen lasziv an ihren fast leeren Milchshake-Gläsern, den Jungs am Nebentisch schmerzt die Hose. Die Kellnerinnen tragen ächzend Spareribs, Bullseyes und Patty Melts an die Tische, den Gästen dringt das Cholesterin aus den Poren, ein Dreijähriger lutscht Mayonnaise aus der Tüte: Supersize Brandenburg. Und ich, mittendrin, bin so beseelt, dass ich mich jedes Mal wieder wundere, dass in meiner Geldbörse nicht Dollarscheine stecken.
Es ist mir alles peinlich, das schon, ich fühle mich dümmer, als ich zu sein hoffe. Das Schlimmste wäre, einen Bekannten zu treffen, der mich hier fressend sitzen sieht, dann könnte ich auch gleich noch ein T-Shirt tragen mit einem Wolf drauf, der den Mond anheult. Aber nicht einmal diese Furcht kann mich von meinem brennenden Verlangen abbringen, Amerikaner zu sein.
Natürlich: Hinterm Kreisverkehr steht ein Kaufland, im Schaukasten hängt die Ankündigung eines CDU-Kinderfestes im Nachbarort, mit Hüpfburg, die Ligusterhecke ist gestutzt, die Bundesrepublik linst misstrauisch hinein in diese Enklave. Doch all das wirkt auf mich, so wild entschlossen, wie ich bin, wie der letzte verblassende Gruß aus einer alten Heimat, die auf der anderen Seite des Atlantiks liegt, das Land der Großeltern, die einst mit dem Schiff hierherkamen, um ihr Glück zu suchen, an diesem Ort, den sie dann als Reminiszenz Brandenburg nannten. Brändenbörg.
Am späten Abend, wie von Hopper gemalt, sitzen die „Nighthawks“ draußen vor dem Diner, Rentner auf dem Weg in den Ostseeurlaub vermutlich, aber das will ich gar nicht wissen, und rauchen ihr Schicksal auf Lunge. Vom Rollladenzubehör-Truck weht ein Mundharmonika-Blues herüber. Der Fahrer muss gleich schon wieder aufbrechen. Er zeigt stumm nach Westen, er meint wohl Kalifornien. Und ich muss jetzt nach Hause. Ich behaupte mal: Dallas.
Goodbye, Diner, my guilty pleasure. Puh, bin ich fett geworden, ich muss den Sitz zurückstellen. Aber: „Live, travel, adventure, bless“, schrieb Kerouac. „And don’t be sorry.“