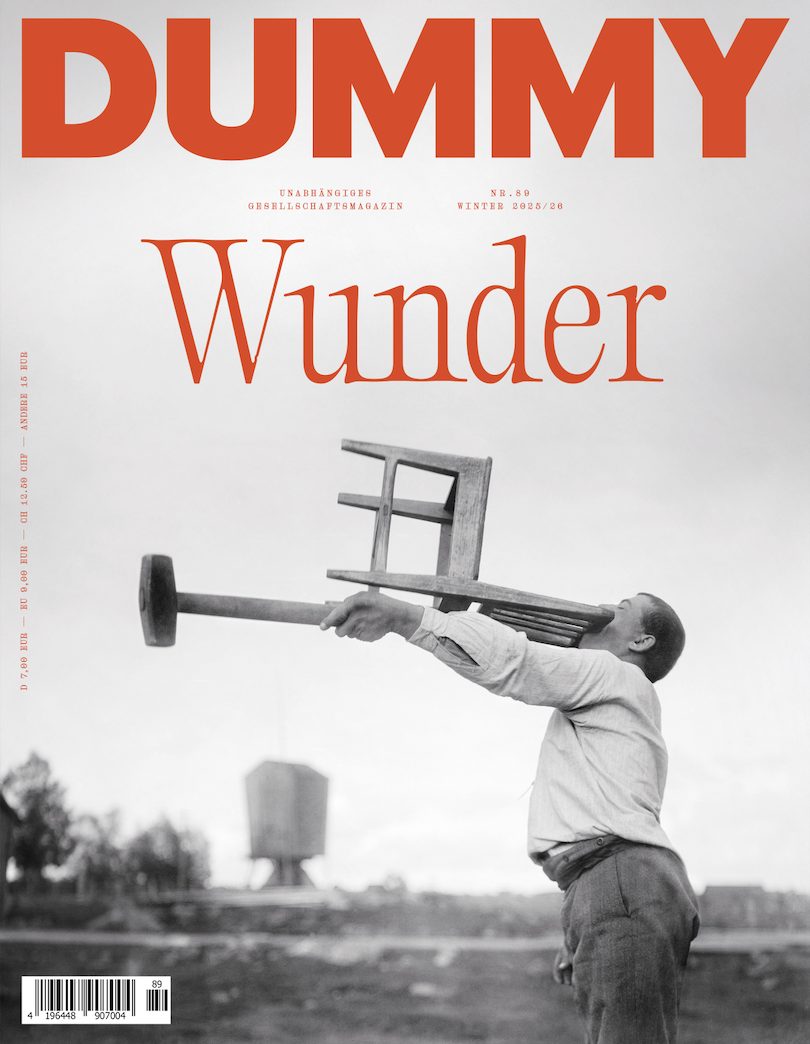Zu Besuch am rechten Rand
Die Autorin Sally Lisa Starken hat im vergangenen Jahr AfD-Wähler gefragt, warum sie eine Partei wählen, bei der viele die Demokratie abschaffen wollen
Von Sally Lisa Starken; Foto: Fabian Ritter
Unsere Welt ist im Wandel. Bei vielen Menschen machen sich deshalb Unsicherheit und Angst breit. Auf der Suche nach neuen Deutungen und Erklärungen verändern sich auch politische Überzeugungen, oftmals verfangen dabei vermeintlich stärkere und einfachere Politikstile. Die Demokratie gerät angesichts dessen immer stärker unter Druck, nicht zuletzt bei Wahlen. Insbesondere der rechte Rand erstarkt mehr und mehr. Kann sich Geschichte wiederholen? Und was kann man tun, damit das nicht passiert? Warum ziehen manche Menschen in unserem Land eine rechte oder gar eine rechtsextremeWeltanschauung als Option, gar als vermeintliche Lösung ihrer Probleme in Betracht? Oft sind diese Fragen mit weiteren verbunden, wie zum Beispiel: Was macht man gegen die Unzufriedenheit, die so viele tagtäglich in ihrem Alltag empfinden? Mit den Mitmenschen, gegenüber der Politik und gegenüber der Situation in unserem Land? Wie holt man jemanden, der am rechten Rand des politischen Spektrums steht, in die Mitte der Gesellschaft zurück, ohne dass er oder sie sich selbst dabei verliert oder sich dafür komplett neu erfinden müsste? Wir können uns fragen, wie es dazu kommen konnte, dass unsere Nachbarin wenig Rente erhält und deswegen jetzt die AfD wählen möchte. Wir können hinhören, wenn unser Arbeitskollege die Schuld für eine ihm widerfahrene Ungerechtigkeit bei Geflüchteten sucht. Wir können mit offenen Augen durchs Leben gehen und versuchen, wieder wirklich miteinander zu sprechen. Fragen, antworten, zuhören. Ja, all das könnten wir. Nur die Realität sieht anders aus. Wir machen es den großen Teil unserer Zeit einfach nicht.
Ich denke, wir haben in manchen Konstellationen einfach verlernt, zu diskutieren, hinzuhören und andere Meinungen für voll zu nehmen. Die Sorgen, Ängste und auch die Wut anderer Menschen zu spüren und sich Gedanken zu machen, wie eigentlich ein wertschätzendes und empathisches Miteinander aussehen würde. Deswegen habe ich mich auf eine Reise durch Deutschland begeben, eine Reise zu einem Anfang mit möglichen. Ich möchte Menschen besuchen. In ihrer gewohnten Umgebung, an Orten, an denen sie sich sicher fühlen, an denen sie bereit sind, offen über ihre Ängste und Hoffnungen zu sprechen. An denen sie auf Augenhöhe darüber reden, wie sie sich ihre Zukunftvorstellen. Ganz sachlich. Aber auch ganz konkret.
Mir scheint, viele Menschen sehen sich subjektiv ungerecht behandelt und befürchten den sozialen Abstieg. Wie schön es da doch wäre, wenn alles so bliebe, wie es in Wahrheit nie war. Auftritt AfD. Einfache Antworten zu komplexen Themen. Die Ausländer. Das Verbrenner-Aus. Gendersternchen. Die Grünen. Die EU. Für viele hat es den Anschein, als würde endlich jemand einmal die wahren Probleme des Landes benennen. Als ob das so einfach wäre, wie es scheint.
In der östlichsten Stadt Deutschlands, in Sachsen
Es ist Ende August 2024. Mit dem ehrlichen Interesse an Begegnungen stehe ich nun also mit meiner Mitarbeiterin Pia auf dem Marienplatz in Görlitz – am Rande einer AfD-Veranstaltung, auf der Alice Weidel sprechen wird. Unter den Menschen ist auch Lea*. Sie ist hier mit einer Freundin. Lea ist um die dreißig Jahre alt und in Görlitz aufgewachsen. Was für uns wichtig ist – sie zählt sich selbst zur Mitte der Gesellschaft. Ihr kommt Görlitz nicht vor wie eine rechtsextreme Hochburg. Görlitz ist ihre Heimat. Dazu muss man wissen: Görlitz wird in den Medien schon seit 2017, als die AfD dort ihr erstes Direktmandat gewann, als Hochburg der Partei angesehen. Bei der Europawahl holte sie 40,1 Prozent der Stimmen. So viel wie in keinem anderen Kreis und keiner anderen Stadt in Deutschland.
Lea erzählt, dass in Görlitz viele gute Menschen wohnen, die einer ehrlichen Arbeit nachgehen, aber am Ende einfach zu wenig Geld in der Tasche haben. Sie versteht nicht, warum Geflüchtete mehr Geld bekämen als Menschen, die hier doch schon immer leben und viel mehr dafür tun würden. Sie betont mehrmals, dass sie „nichts gegen Ausländer“ habe, aber man denke eben doch zuerst an seine Familie und die Menschen, die in Görlitz geboren seien. Lea fühlt sich nicht gesehen von der jetzigen Politik. Dabei bezieht sie sich nicht allein auf die Landtagswahlen, sondern auf die Bundespolitik. „Ich habe die AfD bislang noch nie gewählt, die CDU war eigentlich immer meine Partei. Aber jetzt?“ Sie schaut mich fast verzweifelt an. „Uns Deutsche hat keiner gefragt, ob wir wollen, dass sich unsere Gesellschaft auch kulturell verändert, wenn so viele andere Menschen kommen.“ Sie wiederholt die Aussage, schaut dabei über mich hinweg und denkt über diesen Satz nach. Manchmal fühle sie sich mit alldem so überfordert, dass sie denkt, nicht wählen und einfach keine Entscheidung treffen zu müssen, wäre die beste Alternative.
„N.A.Z.I. – Natürlich, anständig, zuverlässig, intelligent“
Wir fahren weiter nach Suhl, eine kleine Stadt ein paar Kilometer von Erfurt entfernt. Bei der Landtagswahl 2019 war die Gemeinde noch eine linke Hochburg – die Linke lag bei den Zweitstimmen bei 38 Prozent. Doch nun führt die AfD auch hier, dicht gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).
Wir treffen Carsten Schneider. Er ist Ostbeauftragter der Bundesregierung und SPD-Bundestagsabgeordneter. Sein Wahlkreis in Erfurt liegt direkt nebenan. Viele seien misstrauisch, sagt Schneider, ein Misstrauen gegen den Staat, das von Populisten gesät worden sei. Es gebe eine tiefe Verunsicherung. Viele erlebten die Welt über Ausschnitte in den Sozialen Medien und hielten das für die Realität. Und sobald man frage, ob die Person so etwas schon mal in ihrem Umfeld erlebt habe, verneine sie. Der syrische Nachbar sei doch ganz nett.
Seine These ist, der Draht zu diesen Menschen sei gerissen. Und er hat einen Gedanken, der mich weiter begleiten wird: „Wie kommt man an die Menschen wieder heran? Gerade vor Ort ist das ein Problem. Wenn da einfach niemand mehr ist, der dagegenhält. Weil es vielleicht einfach keinen mehr gibt, der sich für eine demokratische Partei engagieren möchte. Oder sich traut. Und dann ist da eben nur noch die AfD …“
Wir gehen durch die Einkaufsstraße zurück zu unserem Auto, um weiterzufahren. Ein Mann steht am Blumenladen und unterhält sich ganz entspannt mit einer älteren Frau. Auf seinem T-Shirt der Aufdruck „N.A.Z.I. – Natürlich, anständig, zuverlässig, intelligent“. Ein Shirt, das man im Onlineshop Ostfront-Versand eines bekannten Neonazis bestellen kann. Kurz denke ich über die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nach.
Eine bestimmte Situation kommt mir wieder in den Sinn. Wir stehen in Nordhausen, die Rede von Björn Höcke auf seinem Sommerfest ist gerade vorbei, und ich spreche zwei Frauen mit Kinderwagen an. Die eine trägt ein Kleinkind auf dem Arm, an der Hand ein vielleicht achtjähriges Mädchen. Sie wollen eigentlich nicht mit mir reden, weil sie immer wieder hören, dass man der Presse nicht trauen kann. Aber ich sehe dann wohl doch ganz nett aus. Sie erzählen mir, dass sie nachts nicht mehr rausgehen würden – aus Angst vor Geflüchteten, die durch die Straßen zögen.
Bei derselben Veranstaltung komme ich mit einer Krankenschwester ins Gespräch, die schon öfter die AfD gewählt hat. Für sie sei Gerechtigkeit wichtig. Als Mutter sei sie dankbar für die Lebensweise, die ihre Vorfahren mit ihrer deutschen Kultur erschaffen hätten, das wolle sie sich nicht nehmen lassen. Sie möchte, dass es ihr und ihren Kindern gut gehe. 2022 habe sie zu Beginn des Ukrainekriegs mitgeholfen, Sachspenden zu sortieren. Aber sie möchte verhindern, dass ihre Kinder im Krieg kämpfen müssen. Sie träumt von einer guten Zukunft für ihre Kinder. Ohne Angst. Sie fragt: „Wann wird es denn endlich besser?“ Diese Frage kann ihr die CDU nicht mehr beantworten. Bei der AfD fühlt sie sich verstanden. Die CDU wieder wählen? Nur wenn die sie nicht mehr anlüge.
Ich erinnere mich an das Gespräch mit Frank in seiner Erfurter Wohnung. Meine Frage, warum er die AfD gewählt habe, wirkt wie ein Funke, der das Feuer in ihm entfacht. Er spricht von Überwachung, Coronamanipulation, Anti-Russland-Propaganda und dass bald alle Männer in den Krieg gegen Russland ziehen müssten. Von seiner Arbeitslosigkeit nach der Wende, von Hoffnungslosigkeit seit dem Mauerfall. Von Björn Höcke, der von Linksextremen bedroht werde. Ich sitze einem verzweifelten und gleichzeitig so wütend wirkenden Menschen gegenüber, der auf keine meiner Fragen zugänglich reagiert. Der nicht mehr in der Realität lebt. Der seine eigene Realität wie eine Festung um sich herum erbaut hat. Sein Rückzugsort, seine Erklärung für alles, was ihm im Leben passiert ist. Seine einzige Hoffnung ist die AfD. Die werde ihm sein altes Leben zurückbringen. Das Leben, wie es war, als es die DDR noch gab. Nach seinen Worten. Seinen Job, seine Frau, sein soziales Leben.
Eine Migrationspolitik, die Sorgen ernst nimmt
Mit jeder Begegnung auf meiner Reise öffnete sich für einen Moment ein Fenster – und gab damit die Sicht auf verschiedene und ganz individuelle Lebensrealitäten frei. Diese sind, so mein Eindruck, zumeist geprägt von negativen oder belastenden Gefühlen wie Ängsten, Sorgen, Wut, aber auch empfundenen Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten, Identitätsfragen oder eben grundlegenden Überzeugungen. Was sich jedoch wie ein roter Faden durchzieht, ist die jedenfalls für mich wesentliche Erkenntnis, dass es selten nüchtern-rationale Abwägungen sind, die dazu führen, die AfD als Problemlöserin zu akzeptieren. In meiner Wahrnehmung sind es emotionale Beweggründe und Argumente, die meine Gesprächspartner*innen für die Erzählungen der AfD empfänglich machen und in deren Zusammenhang sie schlussendlich handeln. Die AfD emotionalisiert stark.
Diese emotionalen Motive wirken wie ein Filter auf die Realität, durch den Fakten und rationale Argumente kaum hindurchdringen. Es entsteht eine Art Parallelwelt oder zweite Wahrheit. Gleichzeitig birgt jede der vorgebrachten Erzählungen ihre eigene Logik – und genau das macht es so schwer, eine allgemeingültige Antwort zu formulieren, warum Menschen die AfD wählen.
Was ich jedoch gefunden habe, ist die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln, wenn auch nur für die Dauer eines Gesprächs. Darin liegt auch eine wichtige Erkenntnis: Die Gründe, warum Menschen die AfD wählen, sind ebenso komplex wie die Sichtweisen unserer Gesellschaft.
Es braucht bessere Antworten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen als die stigmatisierenden, verkürzenden und spaltenden der AfD. Es braucht diese Antworten, um ihr den Nährboden zu entziehen. Sich des Themas Migration und der Sorgen der Menschen anzunehmen, könnte das nicht auch bedeuten, eine Migrationspolitik zu machen, die diese Sorgen ernst nimmt und sich gleichzeitig nicht auf Abschreckung beruft, sondern auch auf Solidarität? Und die Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung mitnimmt?
Will man den Erfolg der AfD brechen, muss gehandelt werden. Die zentrale Aufgabe der demokratischen Parteien besteht darin, die Ängste und Sorgen der Menschen zu hören. Stattdessen beobachten wir jedoch häufig den Versuch der etablierten Parteien, die Rhetorik der AfD zu adaptieren in der Hoffnung, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dabei geben die etablierten Parteien ihre eigenen Positionen auf, in der Folge verschiebt sich der Diskurs nach rechts, ohne dass sie dafür den erhofften Zuspruch bekommen. Die Probleme der Menschen bleiben bestehen, und an den Ursachen, die viele in die Arme der AfD treiben – wirtschaftliche Unsicherheit, das Gefühl politischer Ohnmacht oder kulturelle Überzeugungen –, ändert sich dadurch nichts. Und so bleibt die AfD für viele das „Original“.
Meiner Beobachtung nach dürfen demokratische Parteien nicht bloß reagieren oder kopieren. Sie müssen eigenständige Konzepte entwickeln, die nicht nur Symptome bekämpfen, sondern die strukturellen Ursachen dieser Ängste angehen. Lösungen für wirtschaftliche Sicherheit, Rente, Migration, Identität, Zusammenhalt. Das heißt: Sie müssen diese Buzzwords mit konkreten Zukunftsversprechen füllen.
Und sie müssen diese Konzepte so präsentieren, dass sie Vertrauen schaffen – durch Klarheit, Konsequenz und eine echte Verbindung zu den Lebensrealitäten der Menschen. Wer weiterhin versucht, die AfD mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, läuft Gefahr, sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die eigene politische Identität zu verlieren. Stattdessen müssen demokratische Parteien zeigen, dass sie eine kraftvolle, lösungsorientierte Alternative bieten können, die das Vertrauen in die Demokratie stärkt und den Raum für populistische Erzählungen verkleinert.
Die Frage ist nicht nur, wie wir Menschen zurück in die Mitte holen. Es geht darum, die Mitte so zu gestalten, dass sie für sich selbst spricht: als ein Ort des Dialogs, der greifbaren Ergebnisse und der echten Teilhabe. Eine Politik, die Hoffnung macht, Mut gibt und verbindet, ist keine naive Utopie – sie ist eine Notwendigkeit, um die Demokratie zu stärken und dem Extremismus den Boden zu entziehen und Basis für den gemeinsamen Zukunftsentwurf der Gesellschaft zu sein, der immer wieder neu ausgehandelt wird.
Die Zukunft der Demokratie liegt nicht in den Händen der anderen
Na, so etwa: Ich stelle mir die Gesellschaft wie ein großes Konzert vor, das an einem lauen Sommerabend unter freiem Himmel stattfindet. Die besten Bands der Stadt spielen auf der Bühne, alle sind eingeladen. Es gibt keinen Eintritt, keine Absperrungen, keine VIP-Bereiche. Die Menschen stehen dicht beieinander, lachen, singen, und wenn die Musik einsetzt, spürt man eine gemeinsame Energie, die alle verbindet – unabhängig von Herkunft, Überzeugungen oder Lebensgeschichten.
Das ist die Mitte, die ich mir wünsche: ein Ort, der niemanden ausschließt, der Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Stärke begreift. Ein Ort, an dem sich Menschen zugehörig fühlen und das Gefühl haben, etwas bewegen zu können. Vielleicht ist es naiv, sich so etwas vorzustellen – aber ich glaube, genau solche Bilder brauchen wir. Nicht, um die Probleme der Gegenwart zu ignorieren, sondern um die Kraft zu finden, sie gemeinsam anzugehen.
Denn unsere Demokratie ist nicht statisch. Sie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der von uns allen lebt. Von unserem Widerspruch und unserer Einigung. Von unserem Engagement, unserer Geduld und unserer Fähigkeit, uns zuzuhören. Nicht alles, was wir sehen, wird uns gefallen. Nicht alles, was wir hören, wird uns überzeugen. Aber genau darin liegt die Stärke der Demokratie: in der Vielfalt, im Diskurs, in der Chance, immer wieder besser zu werden.
Die Stimmen des Rechtsextremismus sind laut, die Krisen vielschichtig, die Gräben in unserer Gesellschaft tief. Aber ich bin überzeugt, dass wir mehr sind als das, was uns trennt. Dass in jedem Gespräch, in jeder Debatte und in jedem kleinen Versuch, einander zu verstehen, die Kraft steckt, etwas zu verändern.
Und genau das ist der Schlüssel, den ihr nutzen könnt, um von hier aus weiterzumachen. Fühlt euch nicht machtlos, denn ihr könnt den Unterschied bedeuten. Die Zukunft unserer Demokratie liegt nicht in den Händen der anderen. Sie liegt auch in unseren eigenen.
Auszug aus dem Sally Lisa Starks Buch „Besuch am rechten Rand“, erschienen im Heyne Verlag, 16 Euro
* Namen und Details der Begegnungen habe ich so angepasst, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Personen möglich sind, natürlich ohne dabei die Meinungen oder Ansichten zu verfälschen.