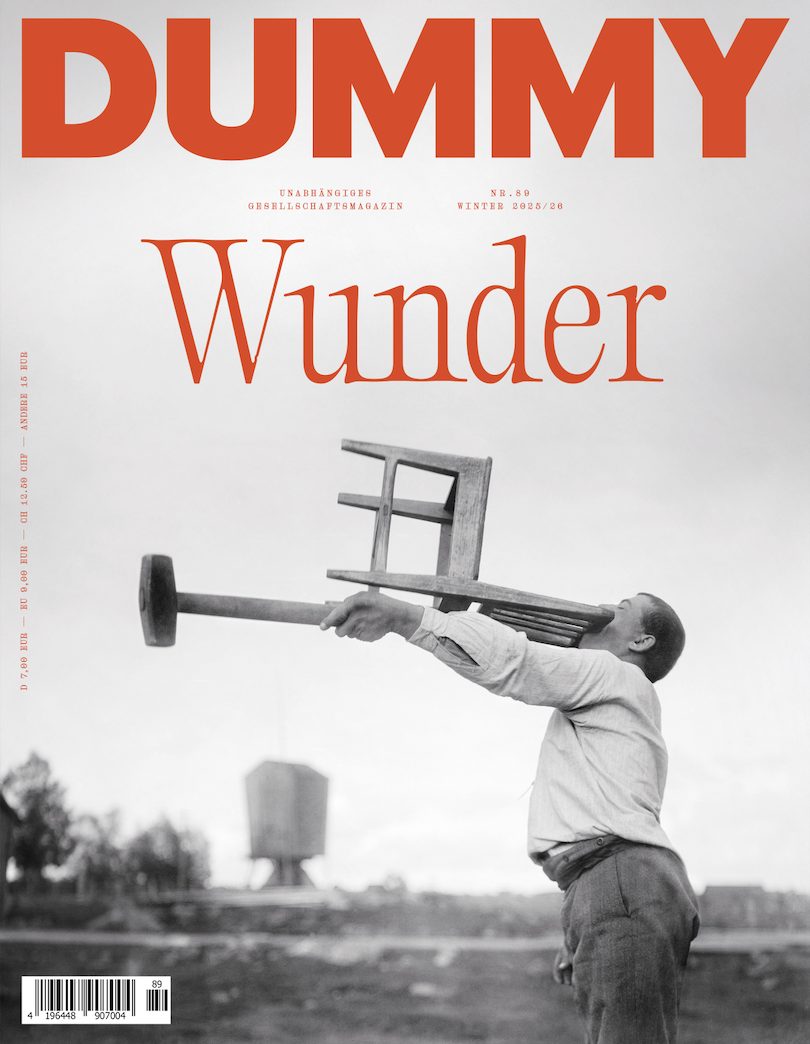Ich gegen mich
Jahrelang hungerte ich mich durchs Leben und glaubte an ein Versprechen, das nie eingelöst wurde: Wenn du dünn genug bist, wirst du frei. Über die zerstörerische Macht der Magersucht – und über den langen Weg der Versöhnung
Von Anna Ruhland
„Ein Erdbeerjoghurt. Ein Stückchen Apfel. Sechseinhalb Salzstangen. Eine Olive. Drei Bissen von einer Laugenstange“, schreibe ich an diesem Abend in mein Tagebuch. „Ca. 328 kcal“, notiere ich darunter. Ich ärgere mich. Die Laugenstange hätte ich mir sparen können. Sparen sollen. Über meiner Essensliste steht mein heutiges Gewicht: 35,8 kg. 200 Gramm mehr als am Tag zuvor. Ich hasse mich. Ich male einen traurigen Smiley unter den Eintrag.
Ich war ein Kind, gerade mal zwölf, und führte bereits einen stillen Krieg gegen meinen Körper, gegen meine Bedürfnisse, gegen jede Stimme, die mir sagte: Du darfst einfach sein. Denn tief in mir gab es eine andere Stimme. Eine, die lauter war als alle anderen. Sie zischelte: „Du bist fast da. Nur noch ein bisschen leichter, dann bist du frei.“
Morgens war der Moment der Wahrheit. Die Zahl auf der Waage entschied alles: Bin ich heute stark oder schwach? Liebenswert oder ekelhaft? Vorm Frühstück drückte ich mich: „Ich esse das auf dem Weg zur Schule.“ Das Brötchen landete im Mülleimer an der Bushaltestelle. Ich erfand Ausreden, wich aus. Irgendwann glaubte es sogar mein Magen. Oder er hatte einfach aufgegeben. Ich zählte Kalorien, wog jeden Bissen ab. Mein Alltag bestand aus Rechnen. Ich fror fast immer, hatte wund gelegene Stellen an meinem Körper, ständig Kopfschmerzen. Mein Herz stolperte manchmal. Aber ich beschwerte mich nicht. Das war der Preis. Denn wenn ich aß, kam alles zurück: das Gefühl, zu viel zu sein. Wenn ich nichts aß, wurde ich unsichtbar. Und das fühlte sich nach Ruhe an.
Engel essen nicht
Ich wusste, dass das krank ist. Aber gesund werden? Das bedeutete aufgeben. Zunehmen. Mich spüren. Und davor hatte ich mehr Angst als vor dem Tod. Der erschien mir beinahe sanft. Nicht zu essen, war mein Weg zu ihm – langsam, kontrolliert. Ich wollte nicht springen, ich wollte verschwinden. Rückblickend ergibt vieles Sinn: Studien zeigen, dass Suizidgedanken bei Menschen mit Anorexie und gleichzeitiger Depression dreimal häufiger auftreten als bei rein depressiven Jugendlichen (46 Prozent versus 14 Prozent). Und doch unternehmen anorektische depressive Jugendliche deutlich seltener „klassische“ Suizidversuche (ein Prozent versus 39 Prozent). Vielleicht, weil ihre Art der Selbsttötung schleichend ist: das Hungern. Der stille Versuch, sich aufzulösen. Und tragischerweise gelingt das immer wieder. Die Mortalitätsrate bei „Anorexia nervosa“ ist die höchste aller psychischen Erkrankungen: 5,86 Prozent. Sie tötet nicht durch Impuls – sondern durch Disziplin.
Nachts, wenn mich der Hunger nicht schlafen ließ, verzierte ich mein Tagebuch mit „Ana-Mantren“.
Ich hatte sie online gesehen in sogenannten Pro-Ana-Foren – eine Welt, in der Magersucht nicht als Zerstörung, sondern als Erlösung gilt („Ana“ steht für Anorexia nervosa). Um mich davon abzuhalten, heimlich zum Kühlschrank zu schleichen, schreibe ich:
„Hunger ist Schwäche, die den Körper verlässt.“
„Wer leicht ist, dem wachsen Flügel.“
„Leere ist Frieden.“
„Die Welt gehört den Unsichtbaren.“
„Engel essen nicht.“
Sätze, die für meine Wahrheiten stehen. Die mir Halt geben und mich gleichzeitig tiefer in die Fänge meiner Krankheit geraten lassen.
Feindin in meinem Kopf
Ich war nie allein. Da war immer sie. Eine verzerrte Version von mir. Schärfer. Klarer. Erbarmungsloser. Sie saß in meinem Brustkorb, unterhalb des Herzens, eingerollt wie ein Tier, das nur darauf wartete, dass ich einen Moment unachtsam bin.
Eine Psychiaterin sagte mir später: „Gib ihr ein Gesicht. Dann kannst du dich besser von ihr trennen.“ Also malte ich sie. Mit durchscheinender Haut, schwarzen Augen, langen Fingern und dünnen Lippen. In meiner Vorstellung trug sie ein zartes Kleid, tänzelte leichtfüßig, fast, als könne sie fliegen. Ich nannte sie: Anorexia. „Welches Verhältnis hast du zu Anorexia?“, fragte meine Ärztin. Ich überlegte. Anschließend schrieb ich in mein Tagebuch: „Anorexia ist wie eine Freundin. Die Art von Freundin, die man bewundert, weil sie schöner, stärker und mutiger ist als man selbst. Sie ist die Einzige, die mich nie im Stich lässt. Aber ich hab auch Angst vor ihr. Ich hab Angst, ihren Ansprüchen nicht zu genügen, sie zu enttäuschen.“
Anorexia war überall. Und sie war immer schneller als ich. Bevor ich essen konnte, war sie da. Bevor ich fühlen konnte, hatte sie entschieden, welches Gefühl erlaubt war. Wenn ich aß, starrte sie mich an, wie eine allgegenwärtige Wächterin. Anorexia schrie nicht. Sie flüsterte. Und das war das Gefährlichste an ihr: Ich hörte sie überall. „Reiß dich zusammen. Iss nichts. Dann bist du sicher.“ Ich glaubte ihr. Weil sie mir Struktur gab. Ihre Regeln fühlten sich für mich an wie ein Korsett aus Stahl. Wenn ich sie befolgte, war ich jemand. Wenn ich sie brach, war ich nichts.
Manchmal versuchte ich, mit ihr zu diskutieren – ist es denn wirklich so schlimm, wenn ich dieses Stück Brot esse? Doch sie hatte immer das letzte Wort: „Du willst Kontrolle. Und Brot nimmt sie dir.“ Irgendwann sah ich mich selbst nur noch in Zahlen. In Gramm. In Spiegelbildern. In durchsichtigen Hautfalten. Ich war ein System aus Regeln, Ritualen, Verboten. Alles Weiche – Hunger, Neugier, Freude – hatte ich in Schichten abgetragen. Bis nur noch eine harte Schale übrig blieb. Heute glaube ich: Vielleicht war genau das mein Ziel. Denn solange ich verschwinde, störe ich niemanden. Solange ich nichts brauche, kann mir nichts genommen werden.
Aber tief in mir, ganz leise, flackerte etwas anderes: eine Sehnsucht. Nach Nähe. Nach Wärme. Nach dem Gefühl, satt zu sein – nicht vom Essen, sondern vom Leben.
Die Lüge von der Leichtigkeit
Ich glaubte, wenn ich nur leicht genug bin, werde ich frei. Ich stellte mir vor, wie eine Feder durch die Welt zu schweben. Keine Schwerkraft, keine Erwartungen. Doch tatsächlich verschwand ich erst aus Gesprächen. Dann aus Momenten. Irgendwann aus mir selbst: Je leichter ich wurde, desto schwerer wurde das Leben. Ich war meine eigene Gefangene.
„Bald“, schreibe ich in Schnörkelschrift in mein Tagebuch. Umrahmt von kleinen lilafarbenen Rosen. Es war mein Versprechen. Mein Grund, weiterzumachen. Nur noch ein Kilo. Nur noch ein Zentimeter Taille. Nur noch einmal hungrig im Unterricht sitzen. Es war nie endgültig. Immer nur: bald. Bald bin ich gut genug. Aber das bald kam nie. Stattdessen verschob sich die Grenze immer weiter. Wenn ich dachte: Ich habe schon so viel abgenommen, sagte Anorexia: „Du kannst das noch besser.“ Wenn mir beim Treppensteigen schwindlig wurde, ermutigte sie mich: „Siehst du, wie stark du bist?“ Und wenn ich zusammenbrach, sagte sie: „Schwach bist du nur, wenn du aufgibst.“ Sie versprach: „Ich lasse dich frei, sobald du dünn bist, das schwöre ich. Wenn du erst einmal dünn bist, ist alles gut.“ Aber sie log. Ich war nie frei. Ich war abhängig. Von ihr. Von dieser Stimme. Von dem Gefühl, mir mein Dasein verdienen zu müssen.
„Wer Spaghetti essen kann, ohne sich dafür zu hassen, muss sich so frei fühlen … Ich wünschte, ich wäre auch frei“, schreibe ich in mein Büchlein – und male ein zerbrochenes Herz daneben.
Ein krankes Ideal
Mit elf Jahren wurde ich das erste Mal stationär aufgenommen. Mein Gewicht lag bei 33,2 Kilogramm. Mein Körper war am Limit, mein Geist kaum ansprechbar. In der Klinik gab es Pläne: 1.800 Kalorien pro Tag, verteilt auf sechs Mahlzeiten. Wer zu langsam aß oder protestierte, bekam eine Ernährungssonde. Ein „Das schmeckt mir nicht“ zählte nicht. Den Wackelpudding durch Joghurt ersetzen? Ging nicht. Stand nicht auf dem Plan. Wer beim wöchentlichen Wiegen das Ziel verfehlte, verlor Besuchszeiten, durfte nicht mit zur Kunsttherapie oder in den Garten. Kontrolle blieb erhalten, nur in neuer Form. Wir saßen im Kreis und wurden mit strengem Blick beobachtet – von den Betreuerinnen, aber auch voneinander. Essen war kein Weg zurück ins Leben. Es war eine Bühne für Scham und Konkurrenz. Auch hier galt Leistung. Nur das Bewertungssystem hatte sich verschoben.
Die empfohlene Gewichtszunahme während einer stationären Behandlung liegt bei 500 bis 1.000 Gramm pro Woche. Doch die psychische Heilung hinkt dieser Zahl meist weit hinterher. Viele Patientinnen nehmen zu, ohne zu genesen. Studien zeigen: Körperschemastörungen, Depressionen und Ängste bleiben – oft werden sie durch das schnelle Zunehmen sogar verstärkt. Ich habe mich und die Welt nie mehr gehasst als in dieser Zeit. Therapieerfolg wurde an der Waage gemessen. Aber niemand fragte, ob ich wieder leben wollte. Oder überhaupt noch konnte. Mehr als ein Viertel der Patientinnen wird im ersten Jahr nach der Entlassung erneut aufgenommen. Ich war eine von ihnen.
Jede magersüchtige Person hat eine individuelle Geschichte, die sie krank werden ließ. Vermeintlich simple Erklärungen wie „Du hast zu viel ‚Germany’s Next Topmodel‘ geschaut!“ werden der Tiefe dieses Leidens nicht gerecht – und doch entsteht Anorexie nicht im luftleeren Raum. Sie wächst in einer Welt, die Selbstoptimierung belohnt, Leistung über Wohlbefinden stellt und Disziplin mit Charakter gleichsetzt. Der Altersgipfel bei Erkrankungsbeginn liegt bei 15,5 Jahren. Die meisten von uns waren Kinder, Jugendliche, als sie anfingen zu hungern. Bis zu 3,6 Prozent der Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens an Anorexie – bei Männern sind es nur 0,3 Prozent. Die Häufung beim weiblichen Geschlecht bedarf laut Deutscher Bundesärztekammer noch weiterer Klärung. Aber Zufall ist das wohl kaum.
Warum trifft es vor allem Mädchen? Vielleicht, weil wir früh lernen, uns anzupassen. Lieb zu sein. Sanft. Schön. Formbar. Bloß nicht zu viel Raum einzunehmen. Weil unser Körper schon kommentiert wird, bevor wir selbst überhaupt ein Bewusstsein für ihn entwickeln. Weil die Gesellschaft uns beibringt: Dein Körper ist dein Kapital. Dein Wert? Verhandelbar.
Schwerer Abschied
Es gab nicht diesen einen Tag, keine große Erkenntnis. Aber je mehr ich darüber sprach – warum Kontrolle mir Sicherheit gab, warum ich übermäßig wachsam war, warum ich Angst hatte, dass niemand mich hört –, desto klarer wurde: Diese Stimme, die ich so lange für meine Freundin gehalten hatte, war meine Feindin. Sie wollte mir nie helfen, sie wollte mich vernichten. Mit der Zeit veränderten sich die Bilder, die ich von Anorexia malte. Aus der feenhaften Gestalt wurde ein Parasit. Klein. Giftig. Hartnäckig darauf bedacht, seine Wirtin nicht zu verlieren.
Und irgendwann wollte ich sie loswerden. Also aß ich. Nicht, weil ich bereit war. Sondern weil ich etwas testen wollte: Ob ich überleben kann, wenn ich Anorexias Stimme widerspreche. Ich überlebte. Ich weinte, ekelte mich, aber ich überlebte. Es war ein zaghafter Beginn. Ein kleiner Riss in einer Mauer aus Regeln. Und ich lernte: Heilung ist kein Sprint. Sie ist das tausendfache Aushalten von Angst. Von Zweifel. Von Selbsthass. Von Hunger nach Kontrolle.
Heute bin ich nicht mehr gefangen, nicht mehr magersüchtig. Ja, ich bin streng zu mir. Die Gedanken, die mich einst bestimmten, existieren in Spuren weiter – wie verblasste Narben. Ich nehme meinen Körper analytisch wahr. Und die verdammten Kalorienwerte der Lebensmittel werde ich wohl nie vergessen. Aber Anorexias Stimme ist verstummt. Ich kann wieder hungrig sein, ohne mich zu hassen. Ich kann satt sein, ohne mich zu schämen. Ich kann leben, ohne mich dafür bestrafen zu müssen. Ich habe mir verziehen. Und ich habe Frieden mit meiner größten Feindin geschlossen.
Zum Heft