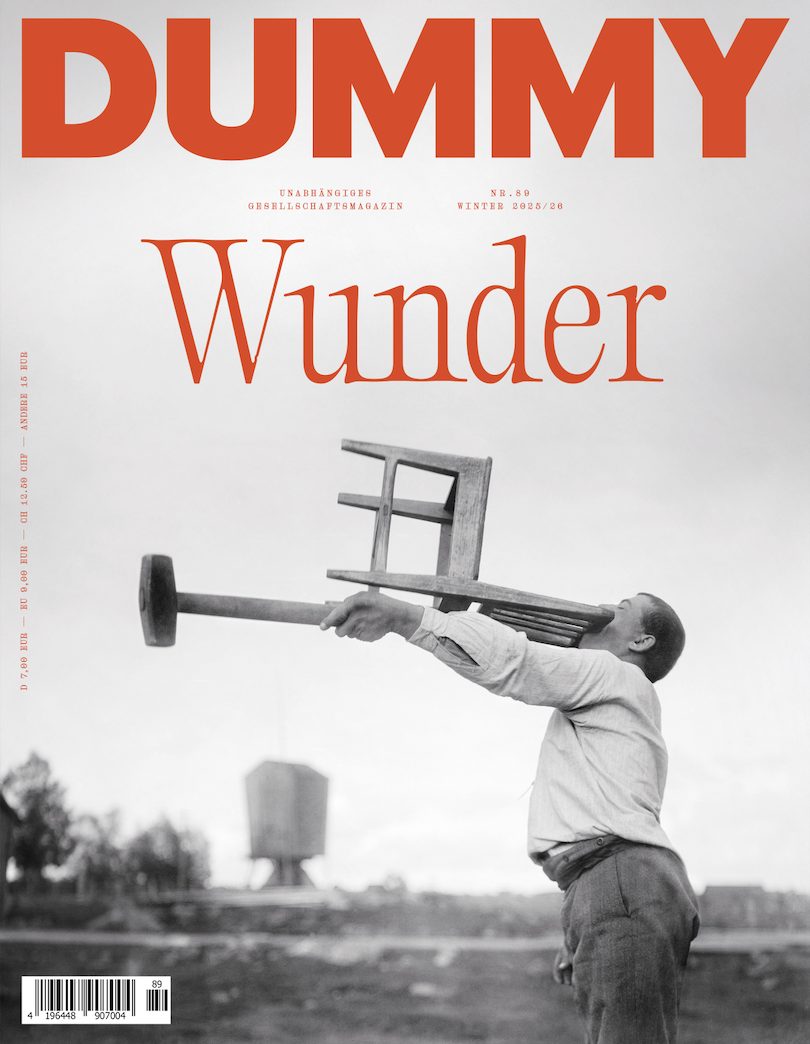Auf sie mit Gebrüll!
Neunzig schwer bewaffnete Polizisten einer Antiterroreinheit stürmen eine Berliner Moschee. Der Verdacht: erschlichene Coronahilfen in Höhe von 5.000 Euro. Wie der Staat Muslime zu Feinden macht
Von Teseo La Marca; Bild: Mirka Pflüger
18. November 2020, kurz vor acht. Ahmad Abu Jebril bringt wie jeden Morgen seinen Sohn zur Kita. Als er die Straße kreuzt, in der die Berliner Furkan-Moschee in einem Hinterhofgebäude untergebracht ist, fällt ihm schon von weitem Blaulicht auf. Die Straße ist gesperrt, Mannschaftswagen und Polizisten stehen vor dem Haus. Ahmad – langes schwarzes Haar, Mitte dreißig – ist kurz irritiert, kann aber keinen Zusammenhang erkennen. Die Moschee, nicht viel mehr als ein Raum mit Teppichen, ist für ihn ein vertrauter Ort. 2014 hat er sie mitgegründet, seitdem ist er dort regelmäßig als ehrenamtlicher Imam tätig. Dass der Einsatz irgendetwas mit dem Gebetsraum zu tun haben könnte, kommt ihm nicht in den Sinn.
Doch kaum hat er seinen Sohn in der Kita abgesetzt, klingelt sein Telefon. Ein Polizeibeamter teilt ihm mit, dass die Moschee sofort aufgeschlossen werden müsse, ansonsten breche man die Tür auf. Ein Missverständnis, denkt Ahmad. Dennoch ruft er zwei Gemeindemitglieder an und bittet sie, zur Moschee zu fahren, während er sich mit der U-Bahn auf den Weg zur Arbeit macht. Im Waggon fällt sein Blick auf den Bildschirm und eine dieser Dauer-News-Schleifen. „Coronahilfen-Betrug! Razzia bei islamischem Verein in Neukölln“, steht da. Und plötzlich begreift Ahmad: Es ist kein Missverständnis.
Polizeieinsätze kennt man in Berlin-Neukölln. Mal ist es ein Wettbüro, das von vermummten Beamten gestürmt wird, mal eine Shishabar. Und manchmal geraten auch Moscheen ins Visier. Aber hier wird es komplizierter: Denn tatsächlich gibt es in Deutschland wenige, in denen radikale Parolen gepredigt werden und die wenig Interesse am Zusammenleben mit „Nichtgläubigen“ haben. Jedoch existieren – da sind sich zahlreiche Islamwissenschaftler und Integrationsexpertinnen einig – auch Moscheen, die viel zur Integration beitragen. So wie die Berliner Furkan-Moschee, wo der in Deutschland geborene Ahmad schon mal einen „Islam made in Germany“ predigt, der weniger dogmatisch ist – wofür er von Islamisten bereits angefeindet wurde. Warum nun also der Polizeieinsatz in der Furkan-Moschee?
Die ganze Geschichte beginnt fast acht Monate vor der morgendlichen Razzia, in der Zeit des ersten Corona-Lockdowns im März 2020. Restaurants, Theater, Kirchen, alles geschlossen. Wie für viele bedeutete die Schließung auch für die Moschee ein finanzielles Problem. Denn wer das Gotteshaus nicht besuchen kann, der spendet auch nicht. Also wurde beschlossen, ein Soforthilfe-Programm des Berliner Senats für Kleinunternehmen und Vereine in Anspruch zu nehmen. Schließlich ist die Furkan-Moschee ein eingetragener Verein, der über Spenden und Mitgliedsbeiträge die Kosten für Miete und Strom aufbringt. Und siehe da, die Investitionsbank Berlin überwies eine Soforthilfe von 5.000 Euro.
Was auf dem Antragsformular der Förderung allerdings nicht stand: Der Verein musste einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, um antragsberechtigt zu sein – Spendengelder gelten dabei nicht als Einkommen. Schon bald begann die Staatsanwaltschaft zu ermitteln: wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug. So wie in etlichen anderen Fällen auch.
„Es wäre Sache der Investitionsbank Berlin gewesen, Einschränkungen der Antragsberechtigung, die nicht im Formular genannt sind, zu prüfen.“ Mit dieser Begründung wies ein Berliner Gericht im März 2022 in einem ähnlichen Fall die Anklage der Staatsanwaltschaft zurück. Auch die Furkan-Moschee wurde Anfang 2023 freigesprochen. Hätte die Bank daraufhin eine E-Mail verschickt und den Verein aufgefordert, den Betrag zurückzuzahlen, wäre die Sache wohl erledigt gewesen.
Aber selbst wenn der Betrugsverdacht stichhaltig gewesen wäre: Die Größenordnung der Razzia war ungewöhnlich. Neben der Furkan-Moschee traf es mindestens vier weitere Berliner Moscheen, auch dort bestand das Vergehen in einem falsch gestellten Antrag auf Coronahilfe, auch dort waren halbe Hundertschaften mit Schutzmontur und Maschinenpistolen, Straßensperren und Spürhunden im Einsatz. Allein in der Furkan-Moschee waren es neunzig Polizeibeamte – wegen eines Verdachts und eines Streitwerts von gerade mal 5.000 Euro.
Das Schlimmste waren die Blicke der Nachbarn und die Gesichter seiner erschrockenen Kinder
Noch mal zurück zum 18. November 2020: In seiner Mittagspause eilt Ahmad in die Moschee und trifft auf entsetzte Gesichter. Die Büroräume sind verwüstet, der Laptop und andere elektronische Geräte beschlagnahmt. Fast alle Türen sind aufgebrochen, auf den Gebetsteppichen Stiefelabdrücke und Hundespuren.
Nicht nur die Moschee wurde von der Polizei durchsucht, sondern auch die Wohnung von einem Gemeindemitglied namens Abdelrahman. Er war derjenige , der für den Moscheeverein den Soforthilfe-Antrag gestellt hatte. Vor seiner Frau und seinen Kindern suchte die Polizei nach Beweisen. Und obwohl er den Beamten seinen Computer gab, auf dem sich der Antrag befand, stellten sie noch den Keller und seine Garage auf den Kopf. Das Schlimmste, erzählt Abdelrahman, seien die Blicke der Nachbarn gewesen und die Gesichter seiner erschrockenen Kinder. „Obwohl ich wusste, dass ich nichts falsch gemacht hatte, kam ich mir vor wie ein Schwerverbrecher.“
Antimuslimische Ressentiments sind in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. Laut dem „Religionsmonitor 2023“ der Bertelsmann Stiftung sieht über die Hälfte der deutschen Bevölkerung im Islam eine Bedrohung. 58 Prozent der nichtmuslimischen Befragten hätten ein Problem damit, in einem Stadtteil mit vielen Muslimen zu wohnen. Mehr als zwei Drittel sind überzeugt, Muslime würden lieber unter sich bleiben.
Alldem wollte Ahmad Abu Jebril als Imam etwas entgegensetzen. Seit der Gründung des Moscheevereins 2014 versuchte er mit seiner Gemeinde, das Vertrauen der Nachbarschaft und des Kiezes zu gewinnen. Zu religiösen Festen verteilten sie Essen und Getränke an Passanten, sammelten Müll von der Straße, engagierten sich im Quartiersmanagement und organisierten gemeinsam mit der Evangelisch-methodistischen Kirche ein jährliches Fußballturnier. Mit den Kirchengemeinden in Neukölln verstand man sich besonders gut. Als Unbekannte eine Kirche mit Steinen bewarfen, hielt Ahmad auf Bitte des Priesters eine Predigt in der Moschee, in der er den Vorfall verurteilte.
Nichtsdestotrotz wurden die Muslime der Furkan-Gemeinde auch immer wieder angefeindet. Skeptische Blicke, Beleidigungen auf der Straße, einmal legten Unbekannte einen abgetrennten Schweinekopf vor die Tür der Moschee. Die schlimmste Erfahrung aber war die Razzia. „Danach haben wir uns nicht mehr getraut, unseren Nachbarn ins Gesicht zu schauen“, sagt Ahmad.
Weil sie überzeugt waren, dass sie nichts Verbotenes getan hatten, suchte die Gemeinde damals einen Anwalt, aber gleich mehrere lehnten ab. Schließlich stießen sie auf Stefanie Schork, die in der Vergangenheit bereits erfolgreich muslimische Gemeinden vertreten hatte und die die Razzia als „völlig unverhältnismäßig“ kritisierte. Als die Mitglieder der Furkan-Moschee dank ihrer Anwältin endlich die Ermittlungsakte in den Händen hielten, waren sie schockiert – jetzt erklärte sich das bis dahin unbegreifliche Ausmaß des Polizeieinsatzes. Die Staatsanwaltschaft ermittelte nicht nur wegen des Verdachts auf „Subventionsbetrug“, sondern auch wegen des „Verdachts auf Terrorfinanzierung“. Daher lag der Fall nicht beim eigentlich zuständigen Finanzamt, sondern bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
Woher der Verdacht auf Terrorfinanzierung rührte, ist bis heute unklar. Bereits ein Jahr nach der Razzia, im Dezember 2021, strich die Staatsanwaltschaft den Vorwurf aus der Ermittlungsakte; es lägen keine ausreichenden Hinweise vor. In Wirklichkeit habe es keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, sagt Anwältin Schork. „In der kompletten Akte gab es keinen Satz, wie dieser Verdacht zustande gekommen sein soll. Das hat die Polizei wohl einfach so hineingeschrieben.“
Der Migrationsforscher Werner Schiffauer hat eine Theorie, wie es zum Terrorverdacht gekommen sein könnte. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Islamismus. Teilweise sehe es der Verfassungsschutz schon als verdächtig an, wenn ein Imam, wie Ahmad, sein Leben streng nach religiösen Geboten ausrichte. Dies werde dann schnell als Salafismus oder als „legalistischer Islamismus“ ausgelegt. Das bedeutet: Nach außen achtet jemand die bestehenden Gesetze, aber nach innen vertritt er ein radikalislamisches Weltbild. Auf diese Weise, erklärt Schiffauer, würden immer wieder nicht nur Islamisten, sondern auch gewöhnliche, sich in der Gemeinde engagierende Muslime als Extremisten gebrandmarkt.
„Viele Muslime denken sich: Ein Staat, der so mit uns umgeht, ist nicht unser Staat“
Ins Visier der Polizei geriet neben der Furkan-Moschee auch die Neuköllner Begegnungsstätte (NBS), eine Moschee, deren Imam Taha Sabri für seine Integrationsarbeit den Landesverdienstorden erhielt. Doch auch sie wurde vom Verfassungsschutz beobachtet. Im Jahr 2018 untersagte das Oberverwaltungsgericht dem Verfassungsschutz, die NBS in seinem Bericht zu erwähnen – das sei „unzulässige Verdachtsberichterstattung“. Auch die Furkan-Moschee wehrte sich juristisch gegen die Einstufung als salafistisch. Bis zu einem endgültigen Urteil darf der Verfassungsschutz sie nicht mehr erwähnen, urteilte ein Gericht. Die Zeitung „Die Welt“ hinderte das nicht daran, Falsches zu verbreiten. Noch im Februar dieses Jahres bezeichnete sie Ahmad als „Islamisten“ – mit Verweis auf den veralteten und zurückgenommenen Verfassungsschutzbericht.
Wie aber kommt es, dass ein Terrorverdacht so schnell in den Raum gestellt wird – und damit selbst liberale Muslime kriminalisiert werden? Laut Migrationsforscher Schiffauer habe man beim Verfassungsschutz und anderen Sicherheitsbehörden das Gefühl, dass der Ermittlungsarbeit viel zu enge rechtliche Grenzen gesetzt seien. Und mithilfe des Terrorverdachts könne man diese umgehen. „Je größer das Monster, das man an die Wand malt, desto schwieriger ist es für den Richter, einen Antrag auf Durchsuchung abzulehnen“, sagt Schiffauer. Was aus sicherheitspolitischer Sicht sinnvoll erscheinen mag, sei für die Integration eine Katastrophe. „Viele Muslime denken sich: Ein Staat, der so mit uns umgeht, ist nicht unser Staat. Manche resignieren und ziehen sich zurück, andere werden empfänglich für radikale Botschaften.“ Und tatsächlich haben radikale Muslime tausendfach das Video von der Razzia in Neukölln geteilt. Ein Versuch, junge Muslime gegen Deutschland aufzubringen.
Auch wenn die Furkan-Moschee vom Betrugsverdacht freigesprochen wurde, hatten die Razzia und der Terrorverdacht gravierende Folgen: So kündigte das Quartiersmanagement die Zusammenarbeit, und aus Angst vor bürokratischen Fehlern beantragte der Vorstand der Moschee keine öffentlichen Förderungen mehr. „Kraft“, sagt Ahmad, „hat mir in dieser Zeit nur die Gewissheit gegeben, in einem Verein zu arbeiten, von dem viele Menschen profitieren.“ Und natürlich der Zusammenhalt in der Gemeinde selbst. Um das Vertrauen der Nachbarn wiederzugewinnen, hätten die Mitglieder der Moschee Datteln an Passanten und Lebensmittel- und Hygienepakete an Obdachlose verteilt. „Zumindest im Kiez“, sagt Ahmad, „ist die Stimmung jetzt wieder harmonisch.“
Sein Sohn, der früher Polizist werden wollte, hat jetzt einen neuen Berufswunsch: Fußballer.
Zum Heft