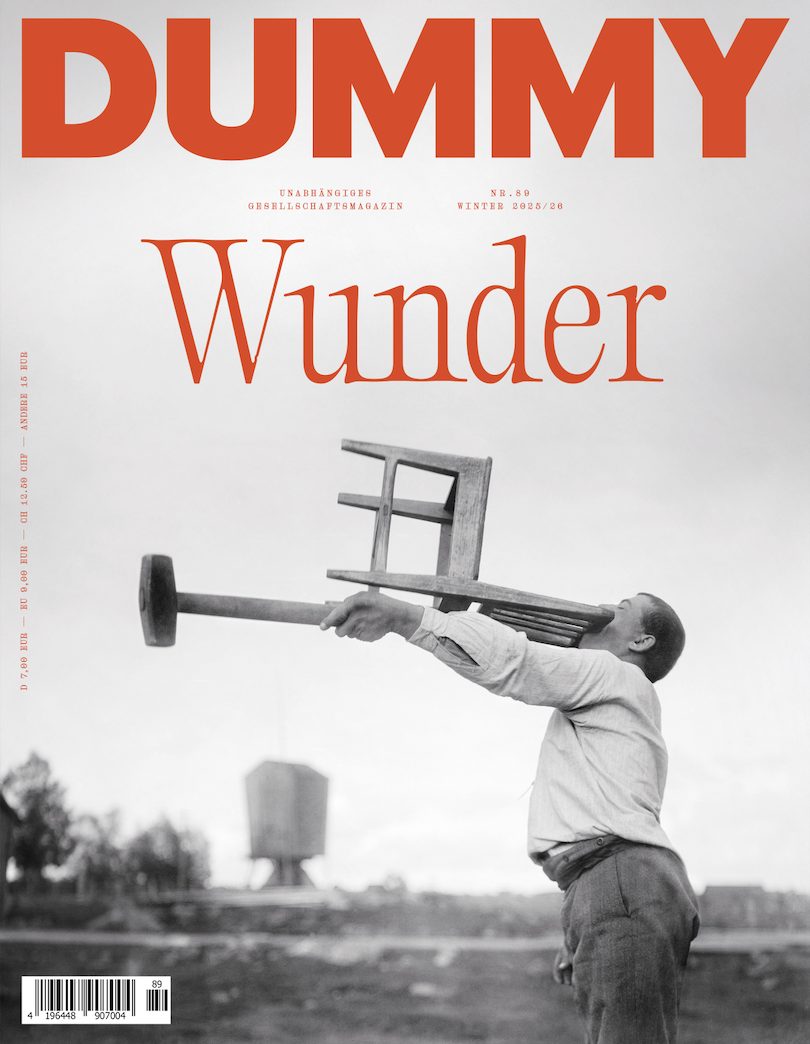Der dermatologische Imperativ
Frauen haben statistisch gesehen einen helleren Hautton als Männer. Sind sie deswegen klüger und kultivierter? Nach der Logik der Rassentheoretiker müsste das doch so sein. Über den Irrsinn des Hautfarben-Wahns
Von Hilmar Schmundt
Weiße Haut, vornehme Blässe, porzellanartige Schönheit, oft besungen, wenig verstanden. Was macht minimalpigmentierte Haut so besonders, was sind ihre Vor- und Nachteile? Zunächst ein kleiner Faktencheck: Homo sapiens hat viele Farben, aber Schwarz und Weiß gehören nicht dazu. Ebenso wenig wie Blau, Lila oder Grün. Weiße Haut?
Eine optische Täuschung. Wir alle sind „Farbige“, mit einem Regenbogen der Sepiatöne. Das belegt das International Skin Spectra Archive (ISSA), das im März 2025 in der Wissenschaftszeitschrift „Sci Data“ vorgestellt wurde. Es basiert auf den Hauttönen von 2.113 Menschen aus aller Welt.
Schon vor fünfzig Jahren stellte Thomas Fitzpatrick, Dermatologe an der Harvard-Universität, seine sechsstufige Lichtempfindlichkeitsskala vor. Phototyp eins für helle Hauttypen, Phototyp sechs für dunkle. Der Phototyp sechs wird vor allem durch Eumelanin eingefärbt, ein dunkelbraunes Polymer, das sich über dem Kern der Hautzellen einlagert und sie wie ein Sonnenschirm vor aggressivem UV-Licht schützt. Beim Phototyp eins dagegen dominiert das Pigment Phäomelanin, es ist eher gelblich-rot. Die Pigmente sind auf der Haut weniger gleichmäßig verteilt, die Flecken heißen Sommersprossen. „Always burns, never tans“, schrieb Fitzpatrick zur vornehmen Blässe des Phototyps eins, der mit einem dreißigfach erhöhten Hautkrebsrisiko einhergeht. Doch die gute Nachricht: Die Minimalpigmentierten sind global gesehen eine winzige Minderheit.
Die Fitzpatrick-Skala ist eine grobe Vereinfachung. Grafikdesigner wissen: Die menschliche Haut umfasst mindestens 130 Farbtöne, vom hellen Beige mit gelblichem Unterton (Pantone 1Y01 SP) bis zum satten Braun mit rötlichem Unterton (Pantone 4R15 SP). Der Regenbogen der menschlichen Haut liegt dabei in der Mitte einer Helligkeitsskala, leicht verschoben ins Dunklere. Seine Polarisierung in Schwarz und Weiß dagegen ist eine kollektive Halluzination, gefeiert von den hellsten Köpfen der Aufklärung.
Kant das sein? Schon im 17. Jahrhundert ging das Meme der weißen und schwarzen Rasse viral
„Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen“, schrieb Immanuel Kant, der Moralphilosoph und Aufklärer. Kants Liebe zu Fitzpatricks Phototyp eins war damals Mainstream. Hundert Jahre zuvor, 1684, hatte François Bernier, ein französischer Weltreisender, einen einflussreichen Artikel veröffentlicht, in dem er die Weltbevölkerung nach vier „Rassen“ sortierte, darunter „schwarz“ und „weiß“. Er selbst war zwar eher skeptisch, was die Tauglichkeit der Haut als Unterscheidungsmerkmal anging, aber andere wischten diese Zweifel beiseite. Das Meme der weißen und schwarzen Rasse ging viral, Biologen wie Carl von Linné schmückten es weiter aus, ein Hirngespinst, dekoriert mit wissenschaftlich wirkender Sprache.
„All men are created equal“, schrieb Thomas Jefferson 1776 in der Unabhängigkeitserklärung der USA, während draußen seine 600 Sklaven schufteten. Ein „unbeweglicher Schleier aus Schwarz“ verdecke „alle ihre Emotionen“, fand der dritte Präsident der Vereinigten Staaten. Sie seien „minderwertig in der Ausstattung von Körper und Geist“. All diese Denker sahen sich selbst als Teil der „Aufklärung“. Noch so ein Propagandabegriff, der Hell gegen Dunkel ausspielt.
Kleiner Reality-Check von Kants dermatologischem Imperativ, der helle Haut bevorzugt: Frauen haben statistisch einen leicht helleren Hautton als Männer, egal in welcher Ethnie. Nach Kants und Jeffersons Logik müssten Frauen also kultivierter, klüger und besser sein als Männer, weil weniger pigmentiert. Aber dieser Binnenwiderspruch passte natürlich nicht ins Haut- und Weltbild der Herrschaften.
Mit neun Kilogramm ist die Haut unser schwerste Organ – und in der Wissenschaft dennoch ein Leichtgewicht
Was also zeichnet „weiße“ Haut aus? Obwohl sie Kant und Jefferson als Goldstandard galt, blieben Wissen und Interesse in Sachen Haut erstaunlich unterentwickelt. Lange Zeit wurde die Haut geradezu „übersehen“, obwohl sie doch mit rund zwei Quadratmetern Fläche das größte und mit neun Kilo Gewicht unser schwerstes Organ ist, schreibt Monty Lyman, der als Arzt an der Universität Oxford praktiziert, in seinem Buch „The Remarkable Life of Skin“ (2018). Die Haut war das letzte Organ, das von der Medizin als ein solches „entdeckt“ wurde: Hiding in plain sight.
Nur rund einen Millimeter dünn ist unsere Schutzhülle aus Keratin, doch sie ist absolut lebensnotwendig, egal ob hell oder dunkel. Zunächst einmal, um den Ozean in uns zu schützen: Wir bestehen zu fünfzig bis siebzig Prozent aus Wasser, ohne Haut würden wir austrocknen, verdunsten, verdursten. So ergeht es manchen Brandopfern, die teils über zwanzig Liter pro Tag trinken müssen. Haut ist dabei keine passive Hülle wie eine Plastiktüte, sondern ein aktiver Teil des Immunsystems, die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger. Erst 1978 wurde das offiziell anerkannt in der Medizin.
Dass unsere Haut nackt und sichtbar ist, liegt an unserem gemeinsamen Migrationshintergrund. Die meisten Säugetiere schützen ihr größtes Organ durch ein struppiges Fell – wie unsere Vorfahren, die Urmenschen. Doch dann wagten die sich eines Tages aus dem Wald und eroberten die Weiten der Savanne. Vor über einer Million Jahre verloren diese Hominiden ihr Fell, um sich durch Schwitzen besser herunterkühlen zu können. Der Mensch hat über zwei Millionen Schweißdrüsen, eine Art eingebaute Klimaanlage. Wir sind die Schwitzweltmeister unter den Tieren, schreibt die Wissenschaftsjournalistin Sarah Everts in ihrem Buch „The Joy of Sweat“.
Aber Schweiß hat seinen Preis: Ohne Fell war die nackte Haut der aggressiven Ultraviolettstrahlung ausgesetzt. Vor allem UV-B kann zu schweren Hautschäden führen und außerdem das lebenswichtige Vitamin B9 abbauen, das als Folsäure für die Fruchtbarkeit wichtig ist. Als Reaktion und körpereigenen Sonnenschutz bildete die Haut daher eine dunklere Pigmentierung.
Doch die Wanderung ging weiter. Nach der Savanne eroberten unsere Vorfahren weitere Lebensräume, immer wieder brachen Migrationsströme aus Afrika in den schummrigen Norden auf. Dort wurde der dunkle Sonnenschutz zum Problem. Nun fehlte Licht, es drohte der Mangel an einem anderen Vitamin. Denn Haut ist nicht nur Festung, sondern auch Fabrik, wie eine solarbetriebene Chemieanlage, die Hormone und Vitamine synthetisiert. Das bekannteste unter ihnen dürfte Vitamin D3 sein, sein Mangel kann zu Brüchen und Osteoporose führen. Vor allem dunkelhäutige Menschen leiden in sonnenarmen Gegenden an Vitamin-D-Mangel.
Der Pigmentierungsgrad folgt also großenteils den Breitengraden: dunkler in den Tropen, heller außerhalb. So einfach ist das
Erneut passte sich die Haut an, über Jahrtausende fuhr sie die für die Savanne optimierte Pigmentierung wieder herunter. Frauen mit hellerer Haut litten weniger an Vitaminmangel und brachten gesündere Kinder zur Welt. Der Pigmentierungsgrad folgt also großenteils den Breitengraden: dunkler in den Tropen, heller außerhalb. So einfach ist das. Und doch im Detail so komplex und schön in seiner fast chamäleonhaften Anpassungsfähigkeit.
Die Abdunkelung der Haut, auch der hellen, entsteht durch Melanin, einen Farbstoff, der von sogenannten Melanozyten produziert wird. Von ihrer Form her erinnern die Pigmentzellen ein wenig an Tintenfische, die auf dem Kopf stehen und durch ihre langarmigen Dendriten Farbstoff in die umgebenden Hautzellen pumpen. Haut ist permanent in Bewegung, die Keratinzellen brodeln empor aus der Unterhaut über die Lederhaut bis zur Oberhaut, jeden Monat wird sie komplett erneuert. Die oberste Schicht besteht komplett aus toten Zellen, täglich fallen sie ab wie Blätter im Herbst und machen rund die Hälfte des Hausstaubs aus.
Hellhäutige haben dabei nicht etwa eine dünnere Haut, sie haben auch nicht weniger Melanozyten, sondern diese sind nur träger, weil sie meist weniger UV abbekommen. Feinfühlig balancieren sie den Hautton aus, hell genug für die Herstellung von Vitamin D, dunkel genug zum Schutz von Vitamin B9.
Auch Menschen mit dunkler Haut können sich einen Sonnenbrand zuziehen, selbst die dunkelsten Hauttöne bieten nur in etwa einen Lichtschutzfaktor 13. Wenn sich also helle Haut in den Tropen nach einer Viertelstunde röten würde, wäre das für die dunkelste Haut nach gut drei Stunden der Fall. Die Fitzpatrick-Skala versprach dunkler Haut „always tans, never burns“, das stimmt nicht und gilt heutzutage vielen als eurozentrisch, sie gaukelt bei dunklen Hauttypen eine trügerische Sicherheit vor. Dunkle Haut ist zwar seltener von aggressiven Krebsarten wie dem Melanom betroffen, doch oft werden Geschwüre erst in einem späteren Stadium erkannt. Das senkt die Überlebensrate erheblich. Bob Marley fiel dem zum Opfer, er starb mit nur 36 Jahren.
Pigmentierungen gegeneinander auszuspielen ist so, als würde man sagen: Nur offene Jalousien sind gut oder nur geschlossene
Deutet angesichts all der eher kleinen Unterschiede irgendetwas darauf hin, dass helle Haut besser ist? Unsinn, es geht nicht um Hierarchie, sondern um Beweglichkeit und Balance. Pigmentierungen gegeneinander auszuspielen ist so, als würde man sagen: Nur offene Jalousien sind gut oder nur geschlossene.
„Intelligence is the ability to adapt to change“, soll der Physiker Stephen Hawking einmal gesagt haben. In diesem Sinne wäre Haut intelligent – nicht weil sie heller oder dunkler ist, sondern weil sie das Potenzial hat, in allen Tönen des Sepia-Spektrums zu schillern, je nach Bedarf. Doch die Anpassung braucht Zeit, das beliebte Vorbräunen auf der Sonnenbank zum Beispiel, um im Urlaub vor Sonnenbrand geschützt zu sein, funktioniert nicht. Urlaubsbräune hat lediglich einen Lichtschutzfaktor 3. Die genetische Anpassung des Hauttons in einer Population dauert zigtausend Jahre.
Die Bevorzugung heller Haut ist dabei nicht erst ein exklusives Privileg hellhäutiger Kolonialherren. Schon in der Antike galt dunklere Haut oft als Zeichen der ungebildeten Stände, die in der Sonnenglut auf den Feldern rackern müssen. Als Aufheller wurden unter anderem Eselsmilch, Essig oder Blei benutzt.
Auch bei dunkelhäutigen Communitys gelten hellere Hauttypen oft als attraktiver. Diese Bevorzugung innerhalb einer Ethnie ist als „Colorism“ bekannt. Rund ein Drittel der Städterinnen in Subsahara-Afrika benutzen Aufhellcremes, schreibt der Arzt Monty Lyman. Viele von ihnen sind gefährlich, sie können Quecksilber enthalten und zu Psychosen oder Nierenversagen führen. Aufgrund des dermatologischen Imperativs, der die Hirne bis heute verwirrt, entfernen Menschen freiwillig ihren evolutionären Hautkrebsschutz, um sich auf Teufel komm raus auf der Fitzpatrick-Skala hinabzubewegen. Absurd.
Längst ist klar: Minimalpigmentierung ist kein Zeichen „größter Vollkommenheit“, sondern eine Reaktion auf Vitaminmangel. Ist dieser Schluss nicht reduktionistisch und biologistisch? Genau, und zwar im besten Sinne. Diese Entzauberung ist hilfreich. Der Kult um helle Haut ist ein Spiegel, in dem die Aufklärung einen ihrer blinden Flecken studieren kann: zwei Quadratmeter groß, neun Kilo schwer.
Zum Heft