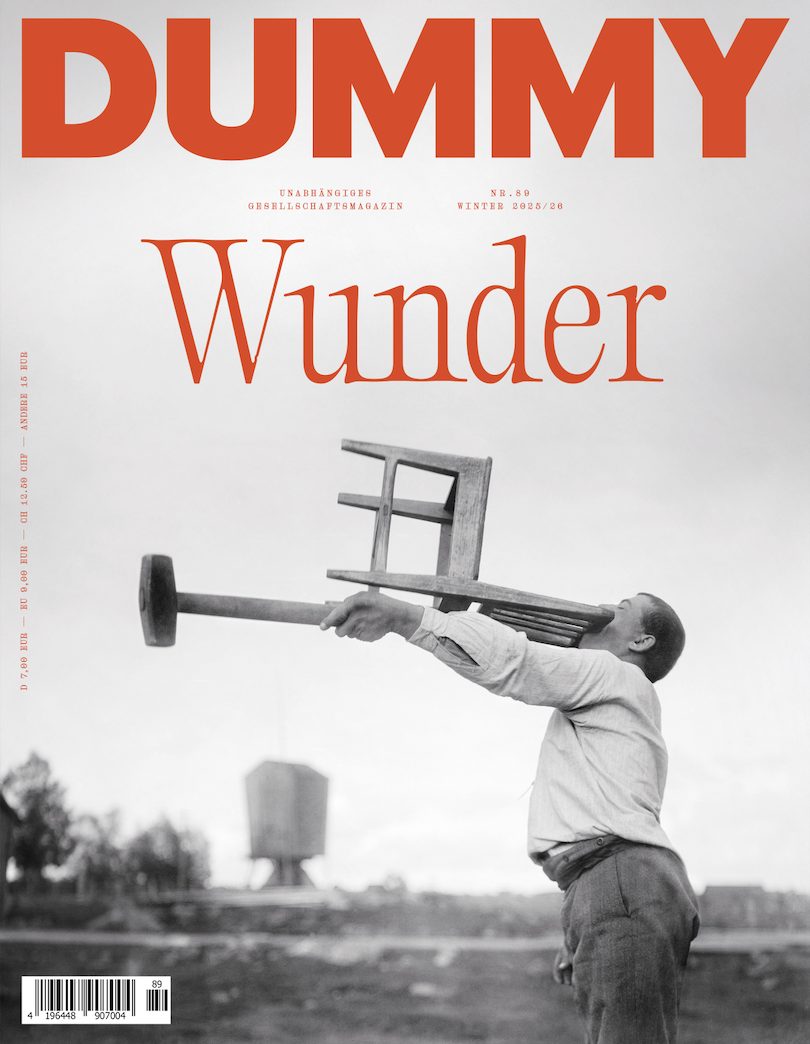Ich Bratkartoffel
Unsere Autorin fühlt sich sehr Weiß, aber wegen ihres Großvaters, der aus dem Irak kam, sieht sie nicht so aus. Ein sehr persönlicher Text über Momente von Scham, Solidarität und Verwirrung angesichts der Gene
Von Julia Tautz; Collage: Simone Karl
2016, Ramallah, Qalandia Checkpoint: Unsere Trekking-Rucksäcke schaukeln auf den Sitzen hin und her, während sich der Bus in einer langen Autoschlange auf den Grenzübergang zubewegt. Als wir aus dem Fenster schauen, entdecken wir zwischen kaputten Fernsehern und Gerümpel das berühmte Banksy-Graffiti mit dem Mädchen, das an einem Luftballon emporzufliegen scheint. Ich schieße ein, zwei Fotos und tauche für einen kurzen Moment in die letzten ereignisreichen Tage in Palästina ab. Plötzlich sehe ich ein Maschinengewehr aus dem Augenwinkel. Eine israelische Soldatin steht vor mir und blickt mich feindselig an. „VISA! VISA!!!“, schreit sie und schwingt ihre Waffe vor meinem Gesicht. Mein Herz macht einen Sprung. Hektisch greife ich zu meinen Dokumenten und erwische zuerst den Pass, den sie gar nicht sehen will. „Show me your Visa!“, fährt sie mich an. Meine Hände zittern, als ich ihr das zerknitterte Papier überreiche. Ihr kritischer Blick sucht nach einem Fehler. Widerwillig gibt sie mir den Zettel wieder, mit einem Gesichtsausdruck, in dem fast Ekel mitschwingt. Meine Freundin, die mit ihren blonden Haaren und Sommersprossen eine Reihe hinter mir sitzt, wird freundlich von einem anderen Soldaten nach ihrem Visum gefragt. Immer noch völlig geschockt, blicke ich ihnen nach, als sie aus dem Bus steigen.
Wenn in Stellenausschreibungen Menschen mit Migrationshintergrund gesucht werden, fühle ich mich in keiner Weise angesprochen. Dabei bin ich eine ganz besondere Spezies mit zwei Backgrounds: einem migrantischen und einem nationalsozialistischen. Deshalb bezeichne ich mich selbst als Bratkartoffel: außen braun, innen weiß.
In der Grundschule wechselte ich nach der zweiten Klasse in die 3e: die sogenannte Migrantenklasse. Polen, Philippinen, Türkei, Ägypten oder Bosnien-Herzegowina –jedes Kind kam aus einem anderen Land, hatte einen anderen kulturellen Hintergrund, und ich mittendrin. Damals war ich extrem angepasst, Klassenbeste, mein Lieblingsfach war Religion. Ich liebte meine Kinderbibel abgöttisch. Mit acht Jahren habe ich mich freiwillig taufen lassen und bin zur Kommunion gegangen. Meine Eltern haben die Welt nicht mehr verstanden. Nach der Grundschule wollte ich unbedingt auf das katholische Gymnasium der Stadt. Ich war mir sicher: Eine Migrantenklasse wird es dort nicht geben. Eine Anpassungsstrategie, die nicht klappte, denn ich fiel auf und wurde zum Gespött der anderen Kinder. „Julia Tautz, kauf dir Enthaarungscreme“, stand eines Tages auf der Tafel. Ich weinte im Mädchenklo und beneidete all meine Freundinnen um ihren zarten, hellen, kaum sichtbaren Flaum am Körper. Und ich begann, die dunklen Haare auf meinen Armen wegzurasieren und mir hellen Puder ins Gesicht zu machen.
Auf Babyfotos guckt mir ein fremdes Wesen entgegen – mit Monobraue und dichtem schwarzen Flaum auf dem Kopf
Denn: Ich bin nicht Weiß. Auf Babyfotos blickt mir ein fremdes Wesen entgegen, mit Monobraue und dichtem schwarzen Flaum auf dem Kopf. Im Sommer werde ich so schnell braun, dass Menschen in meinem Umfeld zu mir sagen: „Du siehst ja aus wie eine Araberin!“ Und dann schaue ich auf meine Arme und denke: Hä, nee! Ich werde einfach nur schnell braun! Das mit dem zu hellen Schminken habe ich inzwischen aufgegeben, und die Haare am Arm rasiere ich mir schon lange nicht mehr ab. Aber ich stehe immer noch jeden Sommer ratlos vor der Kosmetikabteilung in der Drogerie. Meinen Hautton gibt es einfach nicht.
Aber wieso habe ich diesen Hautton?Ich bin in einer gut situierten akademischen Familie am Stadtrand einer westdeutschen Großstadt aufgewachsen. Mein Großvater väterlicherseits kam in den 1950ern aus dem Irak nach Deutschland, um Medizin zu studieren. Er hatte eine Affäre mit meiner Großmutter (ehemals aus Schlesien), sie verlor ihr Herz an ihn, doch dann verschwand er für immer in den Irak. Es ist überliefert, dass er voller idealistischem Tatendrang als Kommunist und Christ sein Land mit aufbauen wollte. Zurück blieb meine Großmutter mit meinem Vater im Bauch. Ein uneheliches, arabisch aussehendes Kind im Nachkriegsdeutschland – es hätte wesentlich einfachere Startverhältnisse für ein Leben in den Fünfzigerjahren geben können.
Mein Vater ist in einer Pflegefamilie groß geworden und hat alles erlebt, was die Bundesrepublik schon damals an Diskriminierung für junge Menschen übrighatte. Seine Mutter starb kurz nach seinem 19. Geburtstag. Ihr Vermächtnis hat sie ihm in seinen vielen Vornamen mitgegeben: slawisch, arabisch, deutsch – und einen polnischen Nachnamen.
Meine Mutter dagegen kommt aus einer reichen deutschen Weißen Familie, die ihr Hab und Gut während des Zweiten Weltkriegs gut zu schützen wusste. Natürlich waren meine Großeltern in der Partei, natürlich gab es das Argument mit der Autobahn. Ich kann nur spekulieren, wie involviert mein Großvater, der als Patentingenieur bei Rheinmetall arbeitete, in das politische Geschehen im Nationalsozialismus gewesen ist.
Wenn ich an meine Großeltern denke, habe ich dunkle Holzmöbel, das grüne Linoleum der Küche und einen Wandteppich mit einem Jagdmotiv vor Augen. Dem Mief der 1960er-Jahre wollte meine Mutter entkommen – mit Rebellion, Rausch und politischer Agitation. Ihr Instrument zur Selbstbehauptung war, wie bei vielen ihrer Generation, schonungslose Provokation. Ihr Blick auf die Welt war radikal. Als meine Eltern sich über das Medizinstudium kennenlernten, lebte mein Vater in einer kommunistischen Kommune, meine Mutter in einem besetzten Haus. Das kulturelle Erbe, das mir in die Wiege gelegt wurde, besingt die Band Ton Steine Scherben mit Keine Macht für Niemand. Es ist wenig verwunderlich,dass meine Großeltern mütterlicherseits meinen arabisch aussehenden Vater nie akzeptierten.
Im Puzzlespiel der Gene habe ich bei meiner Entstehung besonders viel von meinem irakischen Großvater abbekommen. Das führt zu verklemmten Situationen, die mit Fragen wie diesen beginnen:
„Du bist aber nicht deutsch, oder?“
„Wo sind deine Wurzeln?“
„Wo kommst du denn eigentlich her?“
„Bist du Ausländerin?“
„Hast du einen Migrationshintergrund?“
„Sind deine Eltern aus Deutschland?“
Manchmal lasse ich die Fragenden eiskalt abprallen: Ich bin Deutsche. Punkt. Wenn sie weiter nachbohren, erzähle ich manchmal die Großeltern-Story. Aber nur, wenn ich in der Stimmung bin, ihre Neugierde zu befriedigen und ihre Dreistigkeit zu belohnen. Wie alle immer erst ganz interessiert sagen: „Ah, Iran?“ Und ich dann: „Nein, IraK. Mit K.“ Dann gucken sie irritiert und wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen, weil ihnen zum Irak meistens nur Krieg einfällt. Ich lenke dann schnell ein: „Ich weiß aber nichts über die Kultur, nur Gene, sorry!“
Ich will diese Neugierde nicht per se verurteilen, aber sie verunsichert mich. Bin ich etwa weniger deutsch als andere? Jahrelang habe ich in den Spiegel geblickt und mich scheinbar ganz anders wahrgenommen als der Rest der Welt. Dass ich nicht Weiß aussehe, wird mir nur durch den Blick von außen immer wieder vor Augen geführt. Die Gesellschaft übt auf körperliche Merkmale eine Definitionsmacht aus, bei der ich mit meiner selbst empfundenen Identität irgendwie hinterherhinke. Denn aus körperlichen Merkmalen werden kulturelle Erwartungen, mit denen ich konfrontiert werde und die mir immer wieder eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung aufzeigen. Ich habe lange gebraucht, den Blick von außen auf mein Selbstbild anzuwenden. Es ist noch ein langer Weg, bis ich akzeptiere, dass ich nicht so Weiß aussehe, wie ich mich fühle.
Wenn mich Araber nach meiner Herkunft fragen, würde ich gern ihrem Wunsch, eine gemeinsame kulturelle Identität zu teilen, nachgeben.Seit meiner Schulzeit reden Menschen aus einer Selbstverständlichkeit heraus mit mir Arabisch oder Türkisch: ob im libanesischen Restaurant, auf offener Straße oder im Späti. Neulich wurde ich von einer Frau im Supermarkt auf Türkisch angesprochen. Ich schaute verdutzt und zuckte hilflos mit den Schultern. Als sie merkte, dass ich kein Türkisch verstehe, war sie enttäuscht und gestikulierte mit Händen und Füßen. Diese Art von Kommunikation beherrsche ich gut: halb Deutsch, halb Zeichensprache. Meist funktioniert es sogar nonverbal: An einem Silvesterabend war ich auf einer Party. Unter den Gästen war auch ein geflüchtetes Paar aus Syrien. Sie waren beide sehr schüchtern, und ich habe kein Wort mit ihnen gewechselt, aber den ganzen Abend lächelte mich die Frau an. Ich glaubte, so etwas wie Solidarität zu spüren. Ihr Blick sagte: Schön, dass du da bist. Uns verbindet etwas.
Bei all diesen Begegnungen schwingt etwas wie Zugehörigkeit mit, eine Zugehörigkeit, die eigentlich nicht existiert. Aber trotzdem ist sie da. Oder wünsche ich mir das nur? Ist da wirklich ein Gefühl der Verbundenheit? Oder projiziere ich nur meinen eigenen Wunsch danach in diese Interaktionen?
Es gibt auch andere Momente. Beispielsweise in dem türkischen Imbiss bei mir um die Ecke. Da begegnen mir missbilligende Blicke von älteren türkischen Männern, die mich kritisch mustern. Verrate ich aus ihrer Sicht eine Kultur, der ich niemals angehört habe? Oder schauen die immer so griesgrämig?
Besonders in arabischen Ländern können die Menschen mich oft nicht einordnen. Ich verunsichere sie mit meinem arabischen Aussehen in europäischer Kleidung und westlichem Gestus. Sie rufen: „But you don’t look German!“ Und dann bedauern sie mich, weil mir ein kulturelles Erbe abhandengekommen ist. Als ich in Palästina spazieren ging, strahlten mich die Menschen auf der Straße an und riefen: „Welcome home!“ Ein Freund fragte mich neulich, ob mein Background nicht mit einer bestimmten Position im Nahostkonflikt verbunden sein müsste. Ist das so?
Mir wurde eine weitere kulturelle Identität abgeschnitten. Daher fühle ich mich wie eine Hochstaplerin, wenn ich für eine Araberin gehalten werde
Damals, als die USA in den Irak einmarschierten, ging ich mit Freunden auf eine Demonstration, hielt ein Peace-Zeichen hoch und protestierte laut gegen den Krieg. Dabei begleitete mich das seltsame Gefühl, mich müsste das irgendwie mehr beschäftigen als alle anderen. Tat es aber nicht. Der Irak ist ein fremdes Land für mich. Aber die arabische Kultur ist mir vertraut. In meiner Kindheit und Jugend war ich öfter in Hotelresorts in Nordafrika, als ich zählen kann, denn meine Mutter hatte schon immer ein Faible für arabische Länder. Da habe ich das jeweilige Land allerdings nur in touristisch aufbereiteten Häppchen serviert bekommen. Erst im Studium habe ich angefangen, mich mit Nordafrika auseinanderzusetzen: Ich habe an Projekten über den Arabischen Frühling teilgenommen, Schriften von Homi K. Bhabha gelesen und Seminare zum Postkolonialismus besucht. Noch immer reise ich gern in arabische Länder, provoziere ein Klischee, wenn ich mir meinen Schal um den Kopf wickle, und habe mich endlich zu einem Arabischkurs angemeldet. Und doch fühle ich mich in meiner unbeholfenen Annäherung an diese Kultur wie eine Hochstaplerin.
Ich habe ein grundsätzliches Dilemma: Mit meiner deutschen, privilegierten Sozialisation ist die Sicht, die mir auf arabische Länder vermittelt wird, grundsätzlich Weiß. Und wenn ich mich mit arabischer Kultur beschäftige, ist der Grad zwischen legitimem Interesse und kultureller Aneignung sehr schmal, denn ich habe einen Weißen Standpunkt.
Der Farbe meiner Haut ist die Geschichte einer gescheiterten Liebe beigemischt – und ein Familienzweig, der jedoch für immer verloren gegangen ist. Tagtäglich wird mir vor Augen geführt, dass mir eine weitere kulturelle Identität abgeschnitten wurde. Ich würde mich gern über die Kultur meines Großvaters definieren, um mein Aussehen in einen Kontext zu setzen. Manchmal stelle ich mir vor, mein Großvater wäre in Deutschland geblieben und hätte den Kontakt gehalten. Oder dass die Nachforschungen nach ihm nicht im Sande verlaufen wären. Vielleicht hätte ich viel mehr Familie. Vielleicht hätte ich bis jetzt ein ganz anderes Leben gelebt. Vielleicht wäre ich dann mehr als nur eine Bratkartoffel, die zu lange in der Pfanne geschmort hat.
Aber so ist es nicht.
Also muss ich es immer wieder aushalten: die Sehnsucht danach, diese Lücke zu füllen. Weiße sein in nicht Weißer Haut. Es ist eine Stufe der Identitätsverwirrung. Für Menschen, die mit zwei Kulturen aufgewachsen sind und versuchen, sie zu vereinen, ist es vielleicht so, als würden sie in zwei Welten leben und müssten ständig jonglieren. Ich für mich kann sagen: In einer Kultur aufzuwachsen, in der dein Körper von einer Migrationsgeschichte erzählt, die dir selbst fremd ist, fühlst du ständig einen kulturellen Phantomschmerz.
Zum Heft