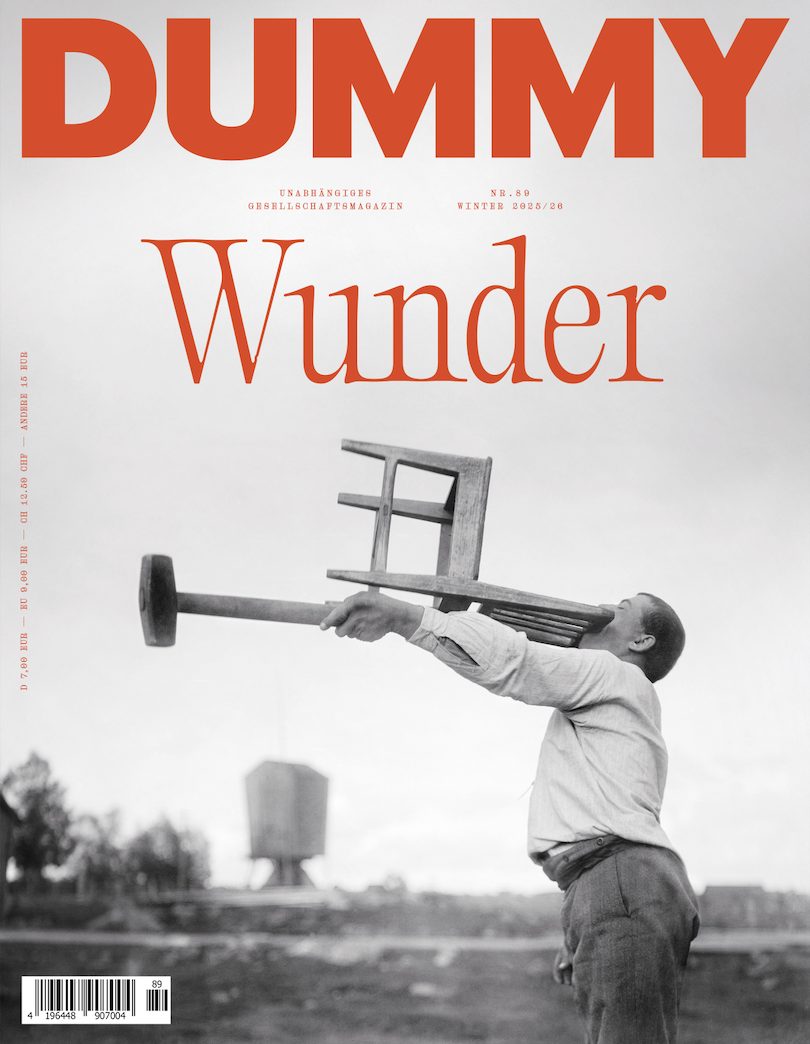Irgendwo muss sie doch sein
Bei ihrer Beerdigung sagte ein Nachbar zu ihm: Nimm es nicht so schwer, Rudolf, das Leben geht weiter. Aber wie?
Von Dirk Gieselmann
Ich habe die Stiefmütterchen erst vorhin gegossen, sagt der Witwer, und jetzt lassen sie schon die Köpfe hängen. Es ist sehr warm an diesem Nachmittag im Mai, in der Woche nach Himmelfahrt. Die Sonne steht im Zenit wie ein falscher Diamant im Schaufenster. Seit zwei Stunden ist der Witwer hier, am Grab seiner Frau. Er hat den Bus um kurz nach zwölf genommen, wie jeden Tag. In einem Beutel hat er eine Brotdose und eine Trinkflasche mitgebracht. Er lebt auf dem Friedhof seit ihrem Tod, seit einhundertneunzig Tagen. Was mache ich nur, sagt er, mit den Stiefmütterchen?
Seine Hände sind braun wie die eines Gärtners. Am Finger trägt er zwei Ringe, seinen und ihren. Bis dass der Tod uns scheidet. Er hat gehofft, den ganzen Winter über, dass es besser wird, leichter, heller, wenn der Frühling kommt. Aber auch die schönen Tage, sagt der Witwer, sind jetzt nicht mehr schön. Im November ist seine Frau gestorben, kurz nach der Zeitumstellung, an einem Donnerstag. Seither ist es dunkel, sagt er, seither ist es schwer. Über ihm, in der Kastanie, singen die Amseln ihr stilles Lied.
Weihnachten, sagt er, war am schlimmsten. Ich hatte nicht mal einen Tannenbaum zu Hause. Er verbrachte den Heiligen Abend auf dem Friedhof, eine elektrische Kerze stand auf dem Grab. Frohes Fest, sagte er zu seiner Frau, wo immer du bist. Als er steif war vor Kälte, fuhr er heim, legte sich ins Bett, neben ihm die leere Seite, das glatte Kissen. Wiedersehen, stand auf den Trauerkarten, ist unsere Hoffnung. Seit einhundertneunzig Tagen ist sie tot.
Neununddreißig Jahre waren sie verheiratet. Bald hätten sie ihre Rubinhochzeit gefeiert, im Sommer. Dann wollten sie noch einmal in den Schwarzwald reisen, wie damals, in den Flitterwochen. Das alte Hotel gibt es noch. Es sieht aus wie damals, sagt er. Ich dachte, ich wäre ein harter Hund. Aber dass sie nicht mehr da ist, macht mich kaputt.
Im August bekam sie Bauchschmerzen, sagt der Witwer, an einem Dienstag, ich weiß es noch genau. Fortan hatte sie keinen Appetit mehr. Sie kochte noch für ihn, aber aß selbst nichts mehr. Sie wurde immer weniger, sagt er. Er brachte sie ins Krankenhaus, aber die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Mestasen, sagt er, der ganze Körper war voll von Mestasen. Er holte sie zurück nach Hause. Noch einen Monat gaben ihr die Ärzte, vielleicht zwei. Sie zeigte ihm, wie man Bettlaken wäscht. Sie war so tapfer, sagt er. Ich habe die ganze Zeit geweint.
Es wäre besser gewesen, sagt der Witwer, wenn ich zuerst gestorben wäre. Sie hätte ohne mich leben können, aber ich nicht ohne sie. Sie hat doch immer alles gemacht, den ganzen Haushalt. Was weiß denn ich, wie man überlebt, ich konnte nicht mal einkaufen. Jetzt bin ich ihr dankbar, unendlich dankbar. Hätte ich das doch vorher gewusst, dann hätte ich es ihr gesagt, jeden Tag, und ihr Blumen mitgebracht. Ich hätte dankbarer sein müssen, sagt er, viel dankbarer. Die Stiefmütterchen sind ganz frisch, ich habe sie doch gestern erst gepflanzt. Und jetzt lassen sie schon die Köpfe hängen. Hoffentlich muss ich nicht mehr lange warten, sagt der Witwer. Wiedersehen ist unsere Hoffnung. Auf dem Grabstein, unter ihrem Namen, ist noch Platz für seinen.
Drei Söhne hatten sie. Die Platane hinterm Haus war so, als sie geboren wurden, sagt er und hält die Hand flach über dem Boden, jetzt ist sie so, er zeigt in den Himmel. Zwei sind fortgezogen, nach Westdeutschland, sagt er. Und einen, den jüngsten, haben auch die Mestasen aufgefressen, sagt er. Er liegt nicht weit von hier begraben, den Weg hinunter, bei den Gießkannen links. Vom Wasserhahn fallen Tropfen in den Staub, als zählten sie die Tage durch. Morgen sind es einhunderteinundneunzig.
Bei ihrer Beerdigung sagte ein Nachbar zu ihm: Nimm es nicht so schwer, Rudolf, das Leben geht weiter. Das war lieb gemeint, sagt er. Aber ich wäre am liebsten hinterhergesprungen in ihr Grab. Er kochte sein Essen nun selbst, Rührei, Kartoffelbrei, sonntags Tomatensalat. Als der Pfeffer aufgebraucht war, rief er die Volkssolidarität an und bestellte Essen auf Rädern. Geliefert wird um elf, er isst oft nur die Hälfte, dann nimmt er den Bus zum Friedhof. Ich bin ganz dünn geworden, sagt er. Wenn sie mich sehen würde, so dünn, sie würde sich Sorgen machen.
Unternimm doch mal was anderes, haben die Söhne am Telefon gesagt, als sie aus Westdeutschland anriefen, geh ins Museum, fahr ans Meer. Aber er kommt noch immer jeden Tag hierher, ans Grab seiner Frau, und setzt sich auf die Bank bei der Kastanie. Um sechs Uhr, wenn die Glocken läuten, isst er das Brot aus seiner Dose. Zwei Witwen sieht er täglich, er nickt ihnen zu, mehr nicht. Aber er fühlt sich ihnen verbunden. Die wissen, wie es ist, sagt er, allein zu sein. Nur das metallische Prasseln des Wassers, wenn jemand die Gießkannen füllt, unterbricht das stille Lied der Amseln.
Vielleicht hört sie mich ja noch, wenn ich mit ihr rede, sagt er. Irgendwo muss sie doch sein. Sie kann doch nicht einfach weg sein, als hätte es sie nie gegeben. Er erzählt ihr, was es zu essen gegeben hat. Verkocht war es mal wieder, du glaubst es nicht. Der Vermieter hat die Fassade streichen lassen, schön sieht das Haus jetzt aus, wie neu. Im Garten spielen die Kleinen von nebenan Verstecken. Bald hat Ingrid Geburtstag, sie wird auch schon fünfundsiebzig. Menschenskind, wie die Zeit vergeht. Ich habe die Zeitung abbestellt, ich lese sie ohnehin nicht mehr. Was interessiert mich noch die Welt. Ich vermisse dich, ich hab dich lieb, bald sehen wir uns wieder.
Er überlegt, ob er in ein Heim ziehen soll. Die Wohnung ist zu groß für einen allein. Er lässt den Fernseher laufen, am Morgen und am Abend, damit er nicht hört, dass sie nicht mehr da ist. Ihre Kleider hängen noch im Schrank, ihr Parfüm steht auf dem Bord. Wir hatten noch so viel vor, sagt er. Er wird bald zweiundsiebzig Jahre alt. Was soll jetzt noch kommen, sagt er, außer Warten.
Es ist der erste Frühling ohne sie. Die Sonne stört mich beinah, sagt er, ja, so ist es, wenn man trauert. Auf dem Grab seiner Frau steht Angelika, das war ihr Name. Darunter ist noch Platz für seinen. Nimm es nicht so schwer, Rudolf. Wiedersehen ist unsere Hoffnung. Daneben liegt eine Tonscherbe mit der Aufschrift DU FEHLST. Die Stiefmütterchen lassen die Köpfe hängen. Was wir brauchen, sagt der Witwer, ist Regen.