Darmwind of Change
Die eigene Verdauung geht eigentlich niemanden was an, aber seit das Mikrobiom in aller Munde ist, gehört es fast schon zum guten Ton, über Bakterien und Stuhlsäulen zu sprechen. Unsere Autorin gibt tiefe Einblicke
Von Anuschka Roshani
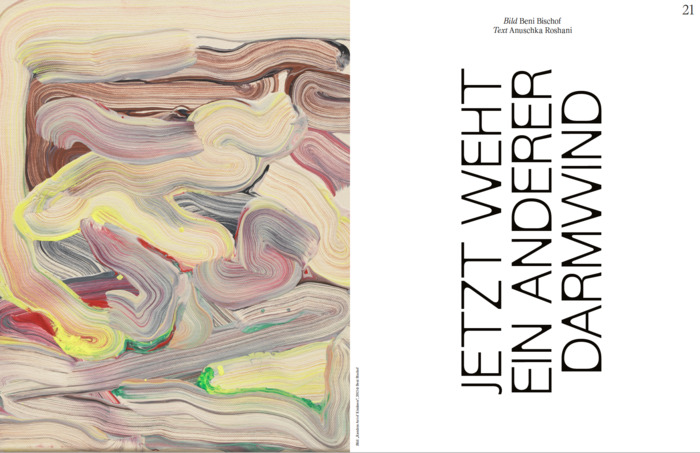
Schöne Scheiße. Dafür, dass ich meinen Körper mit 39 Billionen Bakterien, Viren und Pilzen teile, fühle ich mich ziemlich alleingelassen mit den fundamentalen Niederungen des Lebenskreislaufs: muss auf mich gestellt versuchen, einen Sinn ins Ganze zu kriegen.
Vor rund einem Monat hatte ich nach ungefähr vier Jahrzehnten – genau genommen, seitdem ich als Elfjährige eine Zeit lang mit einem Bandwurm eine (weitgehend) friedliche Koexistenz pflegte – ein bisschen Stuhl in ein Plastikröhrchen gefüllt und dies danach in einem vorbereiteten Umschlag an die Firma Biomes geschickt. Mich lockte deren 149 Euro teures Versprechen, dass ich mich mit dem „ersten vollständigen Darmflora-Test auf Basis mikrobieller DNA“ auf meinen individuellen „Weg zu mehr Lebensqualität“ machen könnte. Nun habe ich einige Seiten Analyse vor mir liegen, doch keinen blassen Schimmer, was eine Gesamtpunktzahl von 68/100 Punkten bedeutet. Zwar werde ich beruhigt, dass ein Wert über 60 für eine intakte Darmflora spreche und nur einer unter 40 für eine „unausgeglichene mit Schwachstellen“ – aber was ist mit dem „auffälligen“ Befund schädlicher Bakterien, dass sich nämlich offenbar zu viele der mir bisher unbekannten Gesellen namens Proteobakterien in meinem Darm tummeln? Eines immerhin ist mir klar: Diversität spielt selbst auf dieser Ebene des gemeinen Lebens eine Riesenrolle, oder in den Worten meines Analysebogens: „Je mehr verschiedene Bakterienarten sich in deiner Darmflora tummeln, umso besser funktioniert dein Stoffwechsel.“
Ist sicher kein Zufall, dass ich an dieser Stelle geduzt werde, schließlich geht es hier um jenen Teil unseres Körpers, der sich in bester Gesellschaft und unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen private parts befindet, und wenn nicht an diesem dunklen Ort, wo sonst ist dann die Intimität zu Hause?Zunächst ein Schritt zurück: Worum geht’s genau? Um die Gesamtheit meiner Darm-Mitbewohner (und Mitbewohnerinnen? Hat ein Pilz, ein Bakterium, ein Virus mehr als ein grammatikalisches Geschlecht?), um all die Mitesserinnen und Mitesser, die sich gierig auf alles, was ich Tag für Tag verspeise, aus reinem Eigeninteresse stürzen. Ohne all diese Mikroorganismen wäre ich aufgeschmissen, also ist es nur gut, dass sie die durchschnittliche Zahl der Zellen eines Menschenkörpers um ganze neun Billionen übersteigen.
Nun könnte ich meinen Darm ja auch einfach mal machen lassen. Zum Glück leide ich unter keiner Krankheit, nur ab und zu unter einem Blähbauch. Aber ich hätte die Zeichen der Zeit nicht erkannt, wollte ich nicht auch bei den Gedärmen auf Selbstoptimierung achten. Und wie oft habe ich inzwischen gelesen, dass das Darmmikrobiom heute als das „zweite Gehirn“ betrachtet wird. Dass alles wieder mal eine Frage des Milieus ist – und wenn das in diesem Bereich gestört ist, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson drohen.Über Jahrhunderte wurde der Darm schamhaft verschwiegen, sofern er seine Arbeit im Normalfall ordentlich verrichtete. Jedenfalls war er alles andere als ein klassisches Tischthema, auch wenn sich mancher Schriftsteller mit Leidenschaft der eigenen Verdauung widmete. „Dunkel, Schnellfall, überstarke Darmwinde“, notierte Thomas Mann in seinem Tagebuch und ein paar Seiten weiter: „Erika las abends aus den Zugvögeln, hübsch. Böse Darmwinde ohne Ergebnis. Schwacher Magen.“
Gut ein halbes Jahrhundert später tauchte Manns würdige Nachfolgerin auf, die 24 Jahre junge Medizinerin Giulia Enders. Aufgebläht formuliert könnte man sagen, dass ihr Bestseller „Darm mit Charme“ 2014 mit über einer Million verkauften Exemplaren einen wahren Paradigmenwechsel einläutete: Darmwinde und Dünnpfiff wurden salonfähig (in der Theorie, nicht Praxis); unter Freunden tat man sich keinen Zwang mehr an, berauschte sich lieber mit Enders’ charmantem Sachbuch am Wunderwerk im eigenen Leib. Auch ich fing an, meine Verdauung ernster zu nehmen, spätestens als mir von allen Seiten Probiotika empfohlen wurden. Plötzlich entdeckte ich Studien über Studien zum Thema: Eine Ernährung mit ultrahochverarbeiteten Nahrungsmitteln wurde mit Depressionen und pathologischen Ängsten in Verbindung gebracht; chronisch entzündliche Darmerkrankungen sollen sogar für Parodontitis verantwortlich sein, und neulich las ich, dass eine regelmäßige Einnahme von Probiotika tatsächlich die Sexualfunktionen der Probandinnen verbessert hätte.
Meine Darmbeschwerden halten sich zwar im üblichen Rahmen, aber was spricht schon gegen ein Tagestütchen Pulver mit 7,5 Milliarden vermehrungsfähigen, aktiven Darmbakterien? Denn was ich ja auch kenne: die mitunter schwere Verkorkung an fremden Orten, fern der Heimat – vermutlich weil ich als Gast ein japanisches Schamgefühl bei Toilettengängen an den Tag lege. Doch auch auf meinem hauseigenen Klo geben sich Frau Obstipation und Herr Durchmarsch gelegentlich die Klinke in die Hand, wobei letzterer dann mit schöner Verlässlichkeit auftritt, sobald eine größere Aufregung in meinen Eingeweiden rumort.
Vor zehn Jahren interviewte ich den britischen Wissenschaftler Tim Spector, der mich in den Begriff der Epigenetik einführte (und das, obschon ich Biologie studiert habe): Umwelteinflüsse, erklärte er mir, bestimmten darüber, welche der persönlichen Gene angeknipst würden und welche ausgeschaltet bleiben. Mit „Umwelt“ meinte der Epidemiologe am Londoner King’s College den Lebenswandel, konkreter: die Lebensmittel, die man tagtäglich zu sich nimmt, zudem die darin enthaltenen Gifte – etwa Pestizide und Schwermetalle – oder ihre guten Bestandteile, der fröhliche Reigen der Vitamine, Spurenelemente, Pflanzenfasern. Aber auch die Berührung mit schädlichen Stoffen wie Asbest, Tabak oder UV-Strahlen.
Spector widmete sich in dem Zusammenhang der Frage, weshalb eineige Zwillinge mit identischem Erbgut unterschiedliche Merkmale aufwiesen – zum Beispiel warum bei dem einen Zwilling im Laufe seines Lebens eine Erbkrankheit ausbrach und der andere verschont blieb.
Ich fragte Spector, inwiefern ihn seine Forschungsergebnisse zu Alltagsumstellungen bewogen hätten. Er antwortete mir, er habe die sogenannten Nahrungsergänzungsmittel ganz fallen lassen, denn Folsäure beispielsweise habe sich als starker epigenetischer Faktor herausgestellt. Von ihm erfuhr ich auch erstmals, dass Sojasauce nicht für alle eine harmlose japanische Zutat auf dem Speisezettel ist – dass Frauen mit einer genetischen Veranlagung für Brustkrebs davon besser die Finger lassen sollten, wogegen es unter Umständen bei jenen, die ein solches Gen glücklicherweise nicht in sich tragen, gerade das Gegenteil bewirke, nämlich präventiv gegen Krebs sei.
Nach meinem Interview mit ihm liebäugelte ich bereits damit, an die Mikrobiom-Datenbank seiner Universität eine Stuhlprobe zu schicken, letztlich war es mir mehrere Hundert englische Pfund nicht wert. Mir fehlte ja eigentlich nichts, und für das Geld konnte ich ja gesundheitsfördernde Probiotikabeutel ohne Ende kaufen. Außerdem machte ich das mit dem Essen wahrscheinlich eh schon richtig. Kaum ein Abend, an dem wir als Familie nicht frisch kochen, höchstens einmal im Monat mit (Bio-)Fleisch. Sowieso klar: Fisch macht schlau (einmal im Monat), Olivenöl extra vergine ist das ultimative Pflanzenöl zum Essen, Raps- und Sonnenblumenöl wegen ihrer ungesättigten Fettsäuren und Nichtacrylamiden sind die besten Öle zum Braten – und selbstverständlich sind Weißmehlprodukte und rotes Fleisch des Teufels, denn das fördert Entzündungsprozesse im Körper, und Gluten ist ohnehin zum Schimpfwort mutiert.
Auch trinke ich brav Granatapfelsaft, weil er so irre gesund sein soll, und im Bioladen kommt mir nur noch Urdinkelbrot in den Einkaufswagen. Und nachdem ich eine Dokumentation über Kurkuma im Fernsehen gesehen habe – in der gezeigt wurde, dass bis zur Einführung von Fast Food in Indien nahezu kein Darmkrebs vorkam, weil das viele Kurkuma im Curry antikarzinogen sei –, rühre ich auch das teelöffelweise ins Essen. Überhaupt halte ich es mit dem Mantra: Iss nichts, was deine Großmutter nicht als Essen erkennen würde!Vor meinem Telefonat mit einer Biomes-Mitarbeiterin bildete ich mir also ein, eine Menge zum Grundsätzlichen zu wissen. Nur mit den Detaildaten tat ich mich schwer. Hinterher war ich leider nicht viel schlauer. Das lag aber nicht an mangelnder Freundlichkeit der Ernährungswissenschaftlerin, vielmehr an der schlechten Telefonverbindung und ihrem starken (französischen?) Akzent. Vielleicht bin ich auch bloß zu doof, um die Auswertung zu lesen: von welchen Bakterien ich nun zu viel und von welchen ich zu wenig habe. Irgendwas stimmte mit meiner Darmschleimhaut und daher mit meinem Immunsystem nicht. Das anaerobe Bakterium Christensenella etwa hatte ich gar nicht, ebenso wie Eubakterium und Lactobacillus. Ausgerechnet bei denen stand auf dem mitgelieferten Erklärmaterial, dass die bei über Hundertjährigen und sehr heiteren Menschen in überdurchschnittlicher Zahl vorhanden seien.
Trotzdem müsse ich mir keine Sorgen machen, alles in allem sei meine Darmflora „ganz gut“. Ich solle fortan raue Mengen Kiwis, Sauerkraut und Bananen verputzen, außerdem gelegentlich Kombucha und Kefir trinken. Dazu täglich noch einen, bald zwei Löffel Flohsamenschalen als Schmiermittel der Verdauung nutzen – und obendrauf auf die gängigen Gesundmacher und -halter achten, auf Bohnen, Linsen, Buchweizen, Hafer, Quinoa, Mais. Kartoffeln, weißen Reis, Pasta und andere raffinierte Weißmehlprodukte meiden oder ganz streichen.
Als ich die Biomes-Mitarbeiterin auf meinen Vermerk hinweise, dass meine Stuhlprobe aus jener Woche stammt, als mich Covid erwischte – was ich lediglich an leichten Magen-Darm-Symptomen bemerkte –, sagt sie, es gebe noch nicht genug Daten, inwiefern das Coronavirus das Mikrobiom beeinflusse. Wolle ich sichergehen, ob das meine Bakterienbalance verdorben hat, dann würde sie mir raten, den Test in einem halben Jahr zu wiederholen. Solange lehne ich mich zurück und halte mich an die Uraltdevise: Abwarten und Tee trinken. Und lass meinen Bauch sich hin und wieder ein wenig gemütlich vorwölben.
Zum Heft